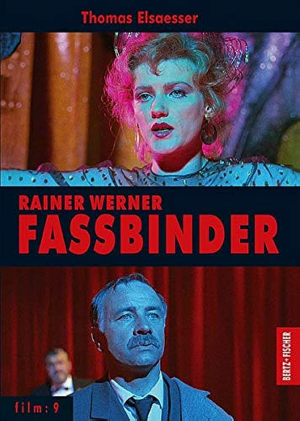»Die Tragödie eines Menschen ist, alles zu vergessen, selbst die Träume der Kindheit. Die Tragödie eines Filmemachers ist, in einem Land groß geworden zu sein, das keine Träume hat, das heißt, das sein Kino vergessen hat.«1
Land ohne Träume: Erinnerung und Identität in der BRD
Die »Hitlerwelle« der frühen 1970er Jahre hatte mit ihrem bevorzugten Blick auf die »Heimatfront« und den Alltag im »Dritten Reich« einen der integralen Bausteine der Nazi-Ideologie fast vollständig ausgeblendet: den Antisemitismus2. Dessen Präsenz in Deutschland ist zwar älter als der Nazismus, aber seine Bedeutung veränderte sich grundlegend mit der Machtübernahme Hitlers, weil den Ressentiments jetzt öffentlich Taten folgten und der geplante Völkermord der »Endlösung« die Entwicklung der gesamten modernen deutschen Geschichte in Frage stellte. Diese Einsicht ließ nach 1945 lange auf sich warten. Weder der Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem noch die Frankfurter Auschwitz-Prozesse ab 1963 hatten ein fundamentales kollektives Nachdenken zur Folge3. Die Geschichte der europäischen Juden, ihre Vernichtung und die Zerstörung ihrer Jahrhunderte alten Kultur blieben, wie die Wurzeln des Faschismus, zwar Forschungsgegenstand akademischer Historiker, aber sie schienen die breite Öffentlichkeit weder zu interessieren noch zu beunruhigen. Das Verhältnis von Juden und Deutschen nach Auschwitz wurde nicht einmal denen zum Thema, die direkt davon betroffen hätten sein sollen. Lange Jahre und oftmals gegen beschämende bürokratische Manöver mussten die Überlebenden der jüdischen Gemeinschaft Fall für Fall erneut um die Errichtung von Gedenkstätten für die Opfer des Holocaust gegen Bundes- und Kommunalbehörden kämpfen. Gleiches galt für die Erhaltung der Internierungs- und Konzentrationslager als Gedenkstätten oder die Benennung von Straßen nach bedeutenden deutschen Juden4.
Aber wenn der Nazismus »bewältigt« werden sollte, bedurfte es eines Verständnisses des Antisemitismus, und wenn der Antisemitismus »bewältigt« werden sollte, bedurfte es Handlungen, die über die Auszahlung von Entschädigungen an die Überlebenden und die sich anschließenden Kompensationsvereinbarungen mit dem Staat Israel hinausgingen. Primo Levi, der von der Roten Armee in Auschwitz befreit worden war und auf seinem Weg zurück nach Italien im Oktober 1945 München passierte, musterte die Gesichter der Menschen nach Zeichen von Erkenntnis oder Entschuldigung:
»Aber niemand sah uns in die Augen, niemand nahm die Herausforderung an: Sie waren taub, blind und stumm, eingeschlossen in ihre Ruinen wie in eine Festung gewollter Unwissenheit, noch immer stark, noch immer fähig zu hassen und zu verachten, noch immer Gefangene der alten Fesseln von Überheblichkeit und Schuld.« 5
Folgt man dem Kulturhistoriker Hermann Glaser6, hätte Levi Gleiches auch dreißig oder vierzig Jahre später über die Mehrheit der Deutschen sagen können. Lange schien es, als ob keine der noch so lauthals verkündeten Verurteilungen des Rassismus die Deutschen dazu zu bewegen vermochte, im einzelnen etwas von der Verantwortung zu übernehmen, die der Naziterror gegen die Juden zu einer unabdingbaren Erbschaft ihres Landes gemacht hatte. Gaben sich die offiziellen Stellen der Bundesrepublik, und insbesondere die konservative Rechte (im Gefolge von Adenauers erster Israel-Reise, die im Mai 1966, also nicht mehr in seiner Amtszeit als Bundeskanzler, stattfand) demonstrativ philosemitisch, so blieben die historischen Wurzeln und die besondere Logik des Antisemitismus ein Tabuthema, an das man besser nicht rührte7. Fassbinder erinnerte sich später, dass ihm als Kind bei Begegnungen mit Juden »hinter vorgehaltener Hand« eingetrichtert worden sei: »Das ist ein Jude, benimm dich artig, sei freundlich!« 8
Soweit es den Antisemitismus betrifft, fallen beim bundesdeutschen Mangel an Einsicht in den siebziger Jahren zwei zentrale Aspekte auf: Zunächst gab es nur verschwindend geringe Kenntnisse von der Geschichte der deutschjüdischen Kultur, die aber unentbehrlich für ein Verständnis der Geschichte des deutschen intellektuellen Lebens mindestens seit der Aufklärung ist. Dann aber existierte auch kein Gefühl persönlicher Schuld oder öffentlicher Scham gegenüber dem Sachverhalt, dass derart viele Bürger die Verbrechen der Obrigkeit gegenüber den Juden zumindest toleriert, oft aber auch offen unterstützt hatten. Letzteres wurde in der Folge häufig auf den Begriff von der »Unfähigkeit zu trauern« und dem Mangel an investierter »Trauerarbeit« gebracht. Trotzdem trifft dies nur eine Seite des Problems: Der Mangel war gepaart mit Heuchelei, wenn alte Nazis, Kriegsverbrecher und wichtige Funktionsträger des »Dritten Reiches« rehabilitiert wurden und ihre alten Posten im Justizwesen, der Medizin oder den Banken erneut einnehmen durften. Während ein Teil des offiziellen Deutschland mit dem »größte[n] Resozialisations- und Reintegrationsprogramm aller Zeiten«9 beschäftigt war, übte sich ein anderer Teil in Lippenbekenntnissen zu den Prinzipien universaler Gerechtigkeit, bestand dabei aber auf einem klaren Bruch mit der Vergangenheit und ermahnte die Öffentlichkeit zu ständiger Wachsamkeit gegenüber dem »Totalitarismus«. Nach dieser de facto »kalten Amnestie« und im Angesicht des »schrecklichen Friedens, der mit den Mördern geschlossen wurde«10, ist es vielleicht nicht allzu überraschend, dass diese herrschende Doppelmoral immer wieder Freud’sche Fehlleistungen bei Figuren des öffentlichen Lebens produzierte und zu Ausrutschern seitens der Politiker führte11.
Der Zynismus, den derlei Taktlosigkeiten in der allgemeinen Öffentlichkeit verbreiteten, half freilich kaum, einer privaten Einsicht Platz zu machen. Zweierlei Maß und verbitterte Resignation waren Symptome dafür, dass es in Westdeutschland misslang, sich mit seinen Bürgern über die Umgangsformen, Gesten und Geschichten zu verständigen, die es erlaubt hätten, sich an die schockierende Realität der NS-Herrschaft zu erinnern, um die Opfer zu trauern und mit einer »Normalisierung« der deutschjüdischen Beziehungen zu beginnen. Auch scheiterte die Bundesrepublik daran – vielleicht nicht mehr oder weniger als andere Länder, aber unter bedrückenderen Umständen –, die menschlichen und zwischenmenschlichen Dimensionen der Judenverfolgung zu verstehen, geschweige denn zu verarbeiten. Impliziert hätte dies beispielsweise auch die Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generation: Stand in den Augen der Welt »Auschwitz« für eine derart dunkle und ungreifbare Realität, dass das Wort »Deutscher« für immer und mitunter auch ausschließlich damit verbunden sein würde, waren viele von den jungen Deutschen auf die Feindseligkeit, die ihnen im Ausland entgegenschlug, nicht vorbereitet. Auch dies ein Grund, warum sich in den wohlhabenden und mobilen sechziger Jahren so viele von ihnen mit unvergleichlicher Gewalt und Intensität gegen ihre Elterngeneration und den westdeutschen Staat wandten, was schließlich in den Terrorismus mündete und so den historisch bedingten intergenerationellen Dissens länger als überall sonst virulent hielt. Die politischen Gewaltakte der siebziger Jahre – komplex motiviert, aber dennoch wesentlich gegen das moralische Fundament der Wiederaufbauanstrengungen gerichtet – haben allerdings den Widerstand der Elterngeneration gegen das Eingestehen der Verbrechen und die Reue eher noch verstärkt. Das jedenfalls ist die Version, die Fassbinder den Zuschauern in der Auseinandersetzung mit seiner Mutter in der von ihm gedrehten Episode von DEUTSCHLAND IM HERBST präsentiert. Doch selbst unter den Protagonisten der Protestbewegung von 1968 waren nur wenige bereit, ihr eigenes persönliches oder politisches Leben mit dem Holocaust oder der jüdischen Existenz auf praktische Weise in Zusammenhang zu bringen. Im Gegenteil – der plakative Philosemitismus der Eltern reizte geradezu zum Antizionismus.
Nachdem über zwei Jahrzehnte bestritten worden war, von der Judenverfolgung oder den KZs überhaupt gewusst zu haben, und als Reaktion auf eine Politik, die einmal als eine »Instrumentalisierung« des Antisemitismus charakterisiert worden ist12, begannen sich die Dinge im Verlauf der siebziger Jahre zu verändern. In der Folge des »Sechs-Tage-Krieges« von 1967 und der Eskalation des israelisch-arabischen Konflikts in den siebziger Jahren, die zu einer scharfen Polarisierung innerhalb der westdeutschen Öffentlichkeit führten, verschoben sich die alten Positionen. Eine Unterstützung der Palästinenser führte fast automatisch zum Antisemitismus-Vorwurf, während rassistische Ausfälle gegen Araber als Ausdruck einer Solidarität mit Israel durchgehen konnten. Die öffentliche Aufmerksamkeit für deutsch-jüdische Geschichte und deutschen Antisemitismus bekam ein anderes Gewicht. Der israelisch-arabische Konflikt machte beispielsweise die Präsenz der Juden in der Bundesrepublik zu einem Medienthema, weil deren Vertreter die Ereignisse im Nahen Osten kommentierten13. Und im Zeichen des Erfolges der Neuen Rechten in der Bundesrepublik überdachte die Linke ihre bisherige Einschätzung des Rassismus, den sie allzu oft zum bloßen Nebenprodukt von Klassenantagonismus und Ausbeutung »erklärt« hatte14.
Selbstbezichtigung nach der Schuldzuweisung?
Letztlich war es der Erfolg der US-Fernsehserie HOLOCAUST (1978; R: Marvin J. Chomsky), der die öffentliche Wahrnehmung aller dieser recht widersprüchlichen Positionen dramatisch veränderte. Die vier Folgen wurden Ende Januar 1979 vom bundesdeutschen Fernsehen – in den dritten Programmen der ARD – ausgestrahlt und erzählten die Geschichte zweier Familien – einer »arischen« und einer jüdischen – von Hitlers Machtübernahme bis zur Vernichtung der jüdischen Familie in Auschwitz. Die erstaunliche Publikumsreaktion auf die Serie ist ausführlich beschrieben und untersucht worden: der Schock der Wahrnehmung, die Tränen, die Bekenntnisse, die hilflosen und hysterischen Ausbrüche in Talkshows und Radiosendungen, aber auch die Empörung und die Debatten darüber, dass es ausgerechnet einer amerikanischen Mini-Serie, die zudem als Seifenoper charakterisiert wurde, gelungen war, das Gewissen der Deutschen aufzurütteln15. Den Kritikern erschien die melodramatische, allzu schwarz-weiß konstruierte Serie ebenso problematisch wie die Frage nach den Konsequenzen der öffentlichen Reaktionen. Erschöpfte sich die Wirkung der Serie in ihrem Kitzel, oder hatte HOLOCAUST vielmehr eine grundlegende und andauernde Katharsis zur Folge? Man kam zu dem Schluss, dass das Fernsehereignis, zumindest für eine Weile, mehr Deutschen als je zuvor klarmachte, dass es eine unteilbare Vergangenheit gab, die (zu) ihnen gehörte, und dass es ihnen nicht freistand zu wählen, was ihnen daran gefiel und was nicht. Voller Gram wurde beklagt, dass man keine Selbstachtung mehr empfinden könne oder dass man zumindest sein weiteres Leben mit einer permanenten Entschuldigung der eigenen Existenz leben müsse. Während manche wissen wollten, welche Taten oder Bezeugungen sie wohl in den Augen der Welt von dieser Schuld entlasten könnten, fragten sich andere, ob es nicht geraten sei, endlich einen »Schlussstrich« unter die Geschichte zu ziehen, gerade weil die Deutschen, wenn sie im künftigen Europa eine Rolle spielen wollen, über einen intakten Patriotismus verfügen müssten16. Identität und Eigenwert drohten zu einer komplexen Konstruktion aus Selbstbezichtigung nach erfolgter Schuldzuweisung zu werden, mitsamt einer untergründigen Aggression, die aus einer solchen »fremdbestimmten« Unrechtsunterstellung resultiert17. Neil Ascherson, der während der siebziger Jahre als Auslandskorrespondent in der Bundesrepublik tätig war, bemerkte einmal, dass »einige Deutsche auf der Straße grüßen, so als würden sie sagen, ›Komm’ her, damit ich Dir meine Überlegenheit beweisen kann.‹« 18
Aschersons Spitze, aber auch Levis Diktum vom »Käfig aus Schuld und Arroganz« bergen Einsichten, die sich Fassbinder zu eigen machte, als er begann, die Bedeutung des Antisemitismus bei der Formierung der bundesdeutschen Identität zu bestimmen: die Notwendigkeit, den Anderen zu (er)finden, um sich selbst zu definieren. Häufig wird dieser Andere mit Eigenschaften ausgestattet, die dem Selbstentwurf zuwiderlaufen oder vielleicht gar hassenswert erscheinen. Schon vor den Reaktionen im Umfeld der HOLOCAUST-Ausstrahlung scheinen Fassbinder diese Mechanismen sehr bewusst gewesen zu sein, und er widmete sich mit großer Aufmerksamkeit den Widersprüchen einer Identitätsbildung, die aus Gefühlen der Verleugnung und dem Bedürfnis nach negativen Definitionen erwuchs. Die geplante Verfilmung von Gustav Freytags Roman Soll und Haben (1855/1977) wollte genau dies zeigen: weshalb die Juden in Abgrenzung sowohl vom alteingesessenen Adel als auch vom anwachsenden Proletariat zum selbstdefinierenden »Anderen« der deutschen Bourgeoisie wurden. Prädestiniert, Fassbinders Geschichte des modernen Deutschland zu eröffnen, sollte die (geplante) Fernsehserie das Wertesystem und die Selbstbilder dieser Klasse profilieren und offenlegen, in welcher Weise diese in einen Antisemitismus mündeten, der nicht eigens artikuliert werden musste, weil er sich quasi von selbst verstand19. Aber bereits ein Jahr zuvor, im März 1976, hatte Fassbinder einen Katalysator für die längst überfällige Debatte zwischen Deutschen und Deutschen sowie Deutschen und (deutschen) Juden geliefert, in der die Fragen nach Antisemitismus und Juden nach Auschwitz in den Blickpunkt rückten – sein Theaterstück Der Müll, die Stadt und der Tod (MST).
Das Ende der Schonzeit: Blasen die Revisionisten zur Jagd?
Während zweier Rückflüge aus New York im Frühjahr 1975 geschrieben und als »Abschiedsgruß« an die Frankfurter Kulturbürokratie gedacht, sorgte MST während des letzten Monats von Fassbinders Intendanz am TAT für einen öffentlichen Aufschrei, wie ihn die Bundesrepublik bis dato nicht erlebt hatte20. Vordergründig geht es im Stück um die Verbindungen zwischen Grundstücksspekulanten, korrupten Kommunalbehörden und Prostitution – darin durchaus der Figurenkonstellation von LOLA ähnlich. Schauplatz ist das einst mondäne, mittlerweile heruntergekommene Frankfurter Westend, und im Mittelpunkt der Handlung steht ein jüdischer Grundstücksspekulant. Die unerwartet hitzige und ungewöhnlich breite Kontroverse, die das Stück bereits vor seiner Veröffentlichung und Aufführung hervorrief, beschäftigte sich kaum mit dem vordergründigen Objekt von Fassbinders bitterböser Satire, der Frankfurter Stadtverwaltung. Auch wurde nicht bemerkt, dass der Tonfall des Stücks eher traurig und melancholisch als wütend war. Stattdessen rückte ausgerechnet eine Hetzkritik in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Joachim C. Fest, dessen 1973 erschienenes Buch Hitler – Eine Biographie erfolgreich der Nostalgie und dem Revisionismus der »Hitlerwelle« den Boden bereitet hatte, ein anderes Thema in den Mittelpunkt: die westdeutsche Linke, deren symptomatischer Ausdruck Fassbinders Stück sei21. Wenngleich Fests Artikel selbst alle Züge einer Erfindung des Anderen aufweist, die lediglich von sich selbst ablenken will und versucht, der verhassten Linken den Rassismus der Rechten aufzubürden, sorgten die Behauptungen von einem »linken Antisemitismus« und einem »moskautreuen roten Faschismus« dafür, dass auch Fassbinders weitere Versuche, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, rigide unterbunden wurden.
Neben dem Soll und Haben-Projekt, das in der Folge des MST-Skandals gestoppt wurde, bekam auch ein Fernsehspiel nach Gerhard Zwerenz’ Vorlage Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond keine Fördermittel mehr und wurde nie produziert. Weil aber Zwerenz’ Roman Fassbinders Stück MST mit einigen Charakteren und dem Frankfurter Lokalkolorit versorgt hatte, ist anzunehmen, dass die Fördergremien die Mittel aus Angst, in solch explosive Angelegenheiten verwickelt zu werden, verweigerten. Dabei beriefen sie sich auf ihre Statuten, die die Förderung von Projekten ausschließen, die rassistische Vorurteile fördern und die Menschenwürde verletzen. Fassbinder hätte der Film die Gelegenheit gegeben, das Thema in dem Medium zu verhandeln, für das es ursprünglich vorgesehen war, zumal das Theaterstück unproduziert blieb und nach dem Frankfurter Debakel zu Fassbinders Lebzeiten nicht für Inszenierungen in anderen Städten freigegeben wurde22.
Es herrscht weitgehende Übereinstimmung darüber, dass Fassbinders Versuche, sich mit dem Thema Antisemitismus auseinanderzusetzen, als Fehlschläge angesehen werden müssen23. Der Kritiker Robert Katz beispielsweise hat MST als einen »Akt der Frivolität [Fassbinders], der ihn teurer zu stehen kam als alle anderen,« 24 bezeichnet. Wenngleich kein Fassbinder-Film zu diesem Thema existiert, erlauben es die Gesamtstruktur wie auch einige Einzelheiten des Stücks, die sich sehr wohl im Einklang mit den moralischen und emotionalen Sichtweisen anderer seiner Arbeiten befinden, sich ein Bild davon zu machen, was Fassbinder bei diesem Projekt umtrieb. Dies umso mehr, als die von MST ausgelöste Aufregung sehr wohl jene »Interventionen« im Kern berührte, die in den siebziger Jahren mit dem Namen Fassbinder (als Autor, Medienfigur und Werkzusammenhang) verbunden waren. Das Theaterstück – und, wenngleich weitaus weniger, auch der Film SCHATTEN DER ENGEL von Daniel Schmid (1976) – traf ins Herz der westdeutschen Anstrengungen, eine kulturelle Identität durch die Auseinandersetzung mit dem Nazismus zu schaffen, ohne sich dabei dem Antisemitismus zu stellen.
Denn die öffentlichen Auseinandersetzungen um MST machen das Stück zu einem »sozialen Text« und damit zu einem Register aller möglichen Missverständnisse und Fettnäpfe, die auftauchen, wenn ein Kunstwerk einen Skandal hervorruft und damit eine Öffentlichkeit produziert. Sie zeigen zudem, dass Fassbinder ein Künstler war, der ein ganz besonders ausgeprägtes Gespür für die unterirdischen Strömungen seiner Zeit besaß. Fälschlicherweise als bloße media events abgetan, können sich solche Kontroversen und Missverständnisse – man könnte sie als »Fehlleistungen der bürgerlichen Öffentlichkeit« bezeichnen – wie in diesem Fall als höchst aufschlussreich erweisen, weil die Teilnehmer der Debatte sich in einer emotional aufgeheizten Atmosphäre miteinander auseinandersetzen, alte Fronten aufreißen und dabei Wahrheiten zu Tage fördern, die auf eine historisch verquere Sachlage recht grelle Schlaglichter werfen.
[Bild 1: Fassbinder als Raoul/Franz und Adrian Hoven als Müller in SCHATTEN DER ENGEL]
Zwei »Hitze-Wellen« sollten unterschieden werden: zum einen die Kontroverse, die sich nach Joachim C. Fests Artikel im März 1976 entzündete und die vornehmlich in Die Zeit und anderen Zeitungen im April des Jahres ausgetragen wurde. Sie basierte auf einem Text, der in einem Buch abgedruckt war, das lediglich in Rezensionsexemplaren kursierte und im wesentlichen prominente Journalisten und Schriftsteller involvierte. Außerdem spielte dabei ein Interview und eine Pressemitteilung von Fassbinder selbst eine Rolle. Die zweite »Welle« folgte neun Jahre später, im Oktober 1985, als nach langen Debatten über Zensur und einem Straßentumult, der einen Frankfurter Theaterdirektor den Job kostete, sich ein anderer Theaterdirektor, Günther Rühle, entschloss, das Stück aufzuführen. Diesmal war es die Jüdische Gemeinde in Frankfurt, die auf die Straße ging und mit einem Sit-in erreichte, dass die Aufführung lediglich hinter verschlossenen Türen vor einer Auswahl geladener Kritiker stattfand.
Als Medienereignis erfuhr die zweite Debatte eine ungleich größere Resonanz. Sechs Jahre nach der Fernsehausstrahlung von HOLOCAUST konnte man des öffentlichen Interesses sicher sein. Joachim C. Fest – erneut dabei – konnte sogar behaupten, dass »die Bücher, Filme, Theaterstücke und Fernsehprogramme, die davon [vom Antisemitismus] handeln, nur noch nach Hunderten zu zählen seien«, fragte aber gleichzeitig, ob »die Verdrängungen, die es zweifellos gibt, nicht auch mit dem Übermaß an moralischen Besinnungsappellen zusammenhängen«25. Die Proteste gegen die Aufführung des Stücks müssen deshalb in einem anderen politischen und kulturellen Kontext gesehen werden, wobei hier nicht nur der historische Antisemitismus im Allgemeinen und die NS-Vergangenheit im Besonderen eine Rolle spielen, sondern auch das nachdrückliche Bemühen der konservativen Bundesregierung, eine politisch akzeptable Formel zur Integration des Nazismus in die deutsche Geschichte zu finden. Hierfür fand sich in akademischen Kreisen der Begriff »Historikerstreit«, in dem, wie bereits erwähnt, Jürgen Habermas gegen die Historiker Ernst Nolte und Andreas Hillgruber polemisch Position bezog26. Politisch artikulierte sich dies Bemühen in den Versuchen der Kohl-Regierung, die deutsche Geschichte durch eine betonte Hinwendung zu Westeuropa zu »normalisieren«, was wiederum nur in scharfer Abgrenzung gegen das andere Andere, den »kommunistischen Totalitarismus« vonstatten gehen konnte. Symbolisiert wurde diese Hinwendung durch die Begegnung von Kohl und Mitterand 1984 auf den Schlachtfeldern von Verdun, um der Toten des Ersten Weltkriegs zu gedenken, und 1985 durch den Besuch von Kohl und Reagan auf dem Soldatenfriedhof in Bitburg. Das Verlangen, die Bundesrepublik als eine gefestigte Demokratie und als Eckpfeiler sowohl der NATO als auch des vereinigten Europa zu präsentieren und somit endlich aus dem Schatten der NS-Vergangenheit herauszutreten, überlebte sogar den Besuch in Bitburg, der dank weltweiter Proteste zu einem empfindlichen Rückschlag und zu einem PR-Desaster des Kanzlers Kohl wurde27.
Die fortwährende Orientierung bundesdeutscher Innen- und Außenpolitik auf das Staatsimage eines mit sich selbst, der Welt und den Nachbarn in Frieden lebenden Landes prallte hart auf die Frankfurter Fassbinder-Kontroverse. Für viele schien es, als ob ein Theaterdirektor allein um des Aufsehens willen ein in Vergessenheit geratenes Stück aus der Versenkung geholt habe, mit dem selbst der mittlerweile verstorbene Autor nichts mehr hatte zu tun haben wollen, um damit die jüdische Gemeinde und auch alle möglichen diplomatischen Eklats zu provozieren. Eine solche Einschätzung wurde beispielsweise vom Stuttgarter Bürgermeister Manfred Rommel, dem Sohn des Feldmarschalls Erwin Rommel, vertreten, als er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels an den Bürgermeister von Jerusalem überreichte28. Aber die geplante Aufführung markierte auch für die Jüdische Gemeinde in der Bundesrepublik eine Zäsur. Offizielle Repräsentanten wie Heinz Galinski und andere Mitglieder des Zentralrates der Juden in Deutschland waren stets diplomatisch und rücksichtsvoll gegenüber deutschen Sensibilitäten gewesen29. Wie übervorsichtige Gäste oder Modellbürger versuchten sie, im bundesrepublikanischen Alltag so wenig wie möglich anzuecken, wahrscheinlich auch, um die Wiedergutmachungszahlungen etwas aus dem Rampenlicht zu holen und für die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde in der Bundesrepublik eine faire und zügige Bearbeitung von Ansprüchen und Beseitigung von Missständen zu erreichen. In den achtziger Jahren geriet diese Führung der jüdischen Gemeinde in den kritischen Blick einer jüngeren Generation, die sich gegen eine solche, wie sie fanden, Appeasement-Politik aussprachen. Wenn zum Beispiel ehemalige Nazi-Richter hohe Ämter bekleideten, wie im Fall des Ministerpräsidenten Hans Filbinger in Baden-Württemberg, der in den letzten Wochen des Krieges noch Urteile nach dem Standrecht gefällt hatte, und die Proteste offizieller jüdischer Sprecher zurückhaltender ausfielen als die manch anderer, keineswegs nur linker Politiker, war dies Gegenstand ihrer Kritik30.
Unter den Anführern der Hausbesetzerbewegung und der Häuserkämpfe der siebziger Jahre in Frankfurt (integraler Teil der Westend-Immobilien-Szene, auf die im Roman von Zwerenz direkt, bei Fassbinder indirekt angespielt wird) war ein Repräsentant der jungen Generation selbstbewusster deutscher Juden: Daniel Cohn-Bendit, besser bekannt als der »rote Dany«, der juif allemand und die Leitfigur des Pariser Mai’68, der im Laufe der achtziger Jahre zu einem prominenten Politiker bei den Frankfurter Grünen wurde, die zu dieser Zeit auch einmal kurzzeitig Koalitionspartner der SPD in Hessen waren. Während der ’85er-Debatte plädierte Cohn-Bendit für eine Aufführung des Fassbinder-Stücks, begrüßte aber gleichzeitig die Militanz der Frankfurter Juden, die sich gegen die Aufführung des Stücks wandten. Wichtig war ihm, dass die westdeutschen Juden sich in der Öffentlichkeit als identifizierbare Gruppe mit formulierten Interessen präsentierten und damit die ihnen zustehende Rolle innerhalb eines, inzwischen durch »Gastarbeiter« und Migranten multikulturell gewordenen Deutschlands voll einnahmen. Für ihn war dies die einzige Alternative zum Aufleben von Antisemitismus, Rassismus und anderen Formen sozialer und politischer Diskriminierung31.
Fassbinder, ein Antisemit?
Auf der Grundlage einer Vergegenwärtigung dieser allgemeinen historischen Veränderungen in der Bundesrepublik während der siebziger und achtziger Jahre wird es einfacher zu verstehen sein, warum Fassbinders Stück zum Katalysator werden konnte und warum Frankfurt, eines der traditionellen Zentren jüdischen Lebens vor dem Zweiten Weltkrieg, zum Schauplatz werden musste – und zwar nicht nur Schauplatz des Stücks, sondern auch der darauf folgenden Kontroversen. Man kann sich zudem fragen, weshalb es Fassbinder gerade mit diesem Stück gelang, Anstoß zu erregen, wenn doch unter den skizzierten allgemeinen Umständen andere Begebenheiten oder Kulturereignisse diese latent vorhandenen Spannungen ebenso gut an die Oberfläche hätten bringen können.
MST benutzt eine kräftige Sprache, ist in sexueller Hinsicht sehr direkt und scheut sich nicht, rassistische Schimpfworte zu gebrauchen, was aber, wie Fassbinder betont hat, den Charakteren, die er vorführe, angemessen sei. Ausgespart und deshalb vielleicht bedrohlich für das Orientierungsvermögen des Zuschauers ist jedoch eine zentrale Bewusstseinsinstanz, die Fassbinders vorsätzlichen Verbalaffront reflektiert, ihn abgleiten lässt oder abmildern könnte. An einer Stelle sinnt die Prostituierte Roma B. über die Gewohnheiten ihres Zuhälters nach:
»Und [er] fragt mich, wie war der Schwanz, Roma, groß oder klein? Konnte er lange, oder kam es ihm schnell? Hat er gestöhnt, will er wissen, Namen genannt – ich hab es vergessen, sag ich, es war mir nicht wichtig. Da kracht es, und die Sterne zucken am Firmament. Und ich lerne mit Bewußtsein, mich ficken zu lassen, mit offenen Ohren und Augen. Was hat er davon? Geht er aufs Klo, onaniert und ist ein andrer Mensch?« 32
Und Hans von Gluck, ein mit dem jüdischen Immobilienhändler konkurrierender Grundstückspekulant, klagt:
»Er saugt uns aus, der Jud. Trinkt unser Blut und setzt uns ins Unrecht, weil er Jud ist und wir die Schuld tragen. [...] Wär er geblieben, wo er herkam, oder hätten sie ihn vergast, ich könnte heute besser schlafen. Sie haben vergessen, ihn zu vergasen. Das ist kein Witz, so denkt es in mir.« 33
Diejenigen Kritiker, die die Vorabexemplare gelesen hatten, fühlten sich durch die Rohheit und das Pornografische des Textes abgestoßen, was sich mit dem Unbehagen angesichts der unappetitlichen antisemitischen Ressentiments solcher Zeilen verbinden musste. So schrieb Jean Améry am 9. April 1976 in der Zeit: »Genet sans génie. Ein auf Frankfurt gekommenes Pseudo-Paris. Unverdauter Georges Bataille. Transgression zu stark herabgesetztem Preis. Dazu raffiniert eingeblendet das Dreigroschenoper-Berlin. Das Ganze, Gott sei’s geklagt, in grundfalschem Büchner-Ton gesprochen«34. Und diejenigen Kritiker, die dem Stück einen gewissen Wert nicht absprechen wollten, sahen es als literarische Fingerübung in der Art von Fassbinders antiteater, eine Zitatencollage aus expressionistischen Dramen von Bertolt Brecht und Ferdinand Bruckner, den Stücken von Ödön von Horváth unter Zuhilfenahme von Christopher Marlowes Der Jude von Malta35. Selbst die, die es verteidigten, gaben zu, dass das Stück »politisch naiv, unbeholfen und unfertig« sei36.
Kritiker, die moralisch brüskiert reagierten, konzentrierten sich auf die Figuren des Stücks – und zwar besonders auf die Figur, der Fassbinder keinen richtigen Namen gegeben hatte, sondern die er als »A. genannt Der Reiche Jude« unter den Dramatis personae geführt hatte, damit dem Stereotyp eine Charakterisierung gebend. Zusammen mit den Hasstiraden zweier erklärter Antisemiten und dem Monolog des »Reichen Juden«, in dem dieser seine strategische Funktion für die Stadtverwaltung reflektiert – als Jude in Westdeutschland gleichzeitig unberührbar und ungerührt zu sein –, schien dies Beweis genug, dass es sich bei dem Stück, wenn auch nicht notwendig mit Absicht, um einen antisemitischen Text handle, der willkommene Munition für den ohnehin latenten Antisemitismus bereitstelle37. Man konnte auch erfahren, dass die meisten der 5000 Mitglieder starken Jüdischen Gemeinde in Frankfurt von sehr bescheidenen Pensionen lebten und manche von ihnen sogar auf Sozialhilfe angewiesen waren38.
[Bild 2: SCHATTEN DER ENGEL: Ingrid Caven als Lily Brest/Roma B.]
Wenn die unterschiedlichen Reaktionen auf das Stück irgend etwas beweisen, dann, dass der Text einen ungewöhnlich großen Anlass für Verstörungen und Missinterpretationen bot. Einen Autor dafür zu tadeln, Risiken einzugehen, unverantwortlich zu handeln, oder ihm vorzuwerfen, die Reaktionen nicht vorhergesehen zu haben, scheint unredlich. Schließlich waren Fassbinders Arbeiten, und nicht zuletzt die Arbeiten fürs Theater, immer auf Provokation hin angelegt39. Als ihn der Theaterkritiker Benjamin Henrichs fragte, ob es nicht ein Fehler sei, wenn sich ein Autor dermaßen in der Wirkung seines Stückes verschätze, antwortete Fassbinder:
»Absolut nicht. Theaterstücke sind immer spontane Reaktionen auf Wirklichkeit gewesen. [...] Das Stück läßt bestimmte Vorsichtsmaßnahmen außer acht, und das finde ich vollkommen richtig. Ich muß auf meine Wirklichkeit reagieren können, ohne Rücksicht zu nehmen. [...] Ich glaube, daß die Reaktionen, so wie sie gewesen sind, mich eher bestärken, daß es richtig war. Ich denke, es ist besser, man diskutiert die Dinge, dann werden sie ungefährlicher, weniger beängstigend, als wenn man nur hinter vorgehaltener Hand darüber reden kann.« 40
Als »sozialer Text« war es vielleicht gerade der Umstand, zu »falschen« richtigen Reaktionen Anlass zu geben, die MST für die Geschichte der Bundesrepublik bedeutsam machte und das Stück gegenüber der klassischen Theater-Moderne, beispielsweise von Samuel Beckett oder Harold Pinter, absetzte. Die Künstler der Moderne versuchten gerade durch eine Reduktion von Realitätsverweisen und durch sprachliche und szenische Präzision potenziellen Fehl-Lektüren entgegenzuarbeiten. Sie werden dabei von einer Kritik unterstützt, die ihrerseits bestimmte Interpretationen als unqualifiziert ausgrenzt und gleichzeitig andere Interpretationen als »kanonisch« festschreibt. So gesehen, handelt es sich bei Fassbinders Stück weder um klassische Literatur noch um ein Werk der Moderne. Noch 1991 stellte der Germanist und Brecht-Experte Reinhold Grimm fest, dass man aufgrund von MST den Dramatiker Fassbinder wohl lieber vergessen solle, und zwar »je gründlicher [...] desto besser«41. Zusammengesetzt aus literarischen Zitaten, sprachlichen Unflätigkeiten, politischen Slogans und emotionalem Exzess ist das Stück bewusst hybride und in gleichem Maße ein Pastiche des Pathos des expressionistischen Dramas wie der happenings der sechziger Jahre. Was dem Stück glückte, war eine Momentaufnahme des politischen Unbewussten der bundesrepublikanischen Gesellschaft mitsamt aller dazugehörigen widersprüchlichen Identifikationen und festgefahrenen Positionen. Zudem bezeugte die ausgelöste Debatte den Wahrheitsgehalt eines Satzes, der im Stück selbst formuliert wird: »Wir verlieren uns in Diskussionen, wo wir schon längst eine Meinung haben.« 42
Unter diesem Gesichtspunkt legte die Debatte die Angreifbarkeit der politischen Kultur der Bundesrepublik bloß: Eine hochpolitisierte kommunal-regionale Förderungskultur fordert vom Künstler eine moralische Verbindlichkeit, die sich nicht allein durch sein Werk artikuliert, sondern die er der Gemeinschaft gegenüber auch in persona vertreten muss. In einer solchen Kultur dient die Kunst der Herstellung einer ausgesprochen traditionellen Öffentlichkeit, in der Repräsentation und Ausgewogenheit notgedrungen eine maßgebliche Rolle spielen. Fassbinder hat auch diesen Widerspruch klar erkannt:
»Ich fürchte, daß sie [die Gremien] die ästhetischen Kategorien gefunden haben. Endlich. Leider. Sie hatten wirklich jahrelang keine, das war unser Glück. [D]ie Gremien und das Fernsehen [waren] über das, was da los war in deutschen Filmen, richtig erschrocken [...]. Da sind Sachen gemacht worden, die haben sie nicht kapiert. Da gab es plötzlich eine Vielfalt von Filmen, die sie nicht mehr überschauen konnten [...]. Es würde allen meinen Vorstellungen vom Staat, der das finanziert, widersprechen, wenn er sagen würde, wir finanzieren einen Hort der Freiheit, und wir lassen Leute wirklich über ihre Realität reflektieren. Das ist dann im rein kommerziellen System wie Hollywood wieder eher möglich.« 43
Vielleicht liegt gerade in dieser Einschätzung ein Grund dafür, warum das staatlich geförderte Theater Fassbinders Interesse niemals wirklich wachhalten konnte, warum er sich vehement dem staatlich geförderten Film widersetzte und stattdessen lieber das Risiko einging, mit einem kommerziellen Filmproduzenten wie Luggi Waldleitner zusammenzuarbeiten44. Als Dramatiker blieb er experimentell, produzierte »offene« Texte, ließ »Vorsichtsmaßnahmen außer acht«, und zielte – ganz im Geiste Antonin Artauds – auf Konfrontation. Therapeutisch oder kathartisch war er bloß insoweit, als er sich vorstellen konnte, auf ein Publikum zu treffen, das sich aufstören ließ oder vielleicht sogar Anstoß nahm. Am Ende der Fassbinder-Debatte standen allerdings weder Aufklärung noch Erkennen, weder reinigende Affekte noch neue Einsichten, sondern allenfalls Frustration und Erschöpfung, zumal die sich gegenüberstehenden Parteien, hauptsächlich Journalisten und Politiker, nicht in ihrem eigenen Namen sprachen, sondern sich mehr oder weniger legitim zu Vertretern einer Sache machten, damit aber andere – durch diese implizite Unterstellung von Unkenntnis – konsequent zum Schweigen brachten. Auch Fassbinder, und insbesondere sein Stück, kamen in beiden historischen Hitzemomenten zumeist nicht zu Wort.
Müll, Stadt und Tod
Der Müll, die Stadt und der Tod blieb in dieser Hinsicht ein Fehlschlag, weil das Stück als Inszenierung am Theater damals und noch viele Jahre keine Öffentlichkeit erreichte45. Versucht man, die Bedeutung der verhinderten Filmproduktionen Fassbinders einzuschätzen, steht man zunächst vor dem Problem, dass ein Schauspiel, ein Kinofilm oder ein Fernsehspiel völlig unterschiedliche ästhetische Objekte sind, sowohl im Hinblick auf ihre jeweilige Textur als auch als Gegenstand einer kritischen Rezeption und mithin der Zirkulation kulturellen Kapitals. Es ist eine Herausforderung, sich vorzustellen, was das gedruckte Stück mit dem Film, den Fassbinder drehen wollte und den dann schließlich Daniel Schmid drehte, gemeinsam gehabt hätte45a. Mit seinen kurzen Szenen und Skizzen in expressionistischer oder Brecht’scher Manier ist MST oftmals wenig mehr als eine Aneinanderreihung von Monologen. Es basiert eher auf einer Logik von widersprüchlichen Gegenüberstellungen als auf einer narrativen Abfolge. Die Kausalität entwickelt sich entlang zerklüfteter Übergänge und innerer Brüche im Gegensatz zum ruhigen Erzählfluss, der Fassbinders Filme selbst dann auszeichnet, wenn die Szenen in engen und klaustrophobischen Interieurs spielen46. Der berüchtigte, oben angeführte Monolog Hans von Glucks beispielsweise wird in SCHATTEN DER ENGEL zu einer tieftraurigen Oratorio aus einer Matratzengruft, und der »Gnadentod« von Lily/Roma B. durch die Hand des »Reichen Juden« gerät zum pas de deux eines zärtlichen Abschieds in Zeitlupentempo.
Stellt man sich MST einmal als Fassbinder-Film vor, weist der Text eine Kohärenz von Motiven, Charakteren und Erzählkomplexen auf, die aus seinen anderen Filmen höchst vertraut sind. Ganz im Stil der »mittleren Periode« steht im Mittelpunkt der Handlung eine Beziehung zwischen zwei Figuren, deren Intelligenz und Innenleben sie von den anderen Figuren abhebt. Hier sind es Roma B. und der »Reiche Jude«, die beide zu viel gesehen und erlitten haben, um sich Illusionen hinzugeben oder mit Zukunftsplänen zu beschäftigen, und deren jeweiliger Blick aufs Leben von jenseits des Grabes zu kommen scheint. Dies verleiht den Figuren eine besondere Würde, die sich durch die Sachlichkeit und Bescheidenheit, mit der sie ihre Bürde tragen, auszeichnet. Roma B. ist die Tochter eines Ex-Nazis, den sie bloß an den Sohn erinnert, den der Vater nie hatte47. Ihr Zuhälter verprügelt sie, um so seiner Liebe Nachdruck zu verleihen, und schickt sie Anschaffen gehen, obwohl sie krank ist, weil sein Stolz als Mann es erfordert, dass er eher ihr Geld verspielt, als sich etwas von seinen Freunden zu leihen. Auch der »Reiche Jude« weiß, was von ihm sowohl von seinen Feinden als auch von seinen sogenannten Freunden erwartet wird, weil er für sie als fixe Größe in einer Rechnung fungiert, die ihn selbst nicht betrifft:
»[D]er Plan ist nicht meiner, der war da, ehe ich kam. Es muß mir egal sein, ob Kinder weinen, ob Alte, Gebrechliche leiden. [...] Und das Wutgeheul mancher, das überhör ich ganz einfach. Was soll ich auch sonst. [...] Soll meine Seele geradestehen für die Beschlüsse anderer, die ich nur ausführe mit dem Profit, den ich brauche, um mir leisten zu können, was ich brauche? Was brauch ich? Brauche, brauche – seltsam, wenn man ein Wort ganz oft sagt, verliert es den Sinn [...]. Die Stadt braucht den skrupellosen Geschäftsmann, der ihr ermöglicht, sich zu verändern«48.
Zu einem Geschäft wird seine Beziehung zu Roma B., als er deren Dienste kauft, um sie als Waffe gegen ihren Vater Herrn Müller zu benutzen, einen abstoßenden Nazi, der keine Reue kennt und dessen Frau an den Rollstuhl gefesselt ist. Als berufsmäßiger Transvestit singt er in einer Bar Zarah-Leander-Songs, wo ihn der »Reiche Jude« ausfindig macht, der ihn für den Mörder seiner Eltern hält. Überzeugt davon, dass der Faschismus schließlich triumphieren wird, zeigt Herr Müller keinerlei Emotionen, als er mit den Anschuldigungen konfrontiert wird:
»Ich habe mich um den Einzelnen, den ich tötete, nicht gekümmert. Ich war kein Individualist. Ich bin Technokrat. Aber es ist möglich, daß ich der Mörder seiner Eltern bin, und ich wäre es gern. Also bin ichs.« 49
Als der »Reiche Jude« Roma B. kennenlernt, beginnt er sich um sie zu kümmern, während sie, die ihren Aufstieg seiner Bekanntschaft verdankt, sich mehr und mehr isoliert fühlt. Franz B. hat sich in der Zwischenzeit in einen Mann verliebt, dessen Freunde Franz auspeitschen, seinen Kopf unter Wasser drücken, ihn vergewaltigen und mit Ketten schlagen, ganz so, wie er es sich wünscht. Erschöpft vom Leben in Städten, in denen das Leben dem Tod ähnlicher ist als der Tod selbst, bittet Roma B. um ihren Tod, aber niemand findet die Zeit, ihr den Wunsch zu erfüllen. Schließlich erbarmt sich ihrer der »Reiche Jude« und erwürgt sie mit seiner Krawatte. Die Polizei, die einen Täter liefern muss, verhaftet schließlich Franz B., den perfekten Strohmann, weil er sich geradezu feilbietet.
[Bild 3: Mann mit zwei Gesichtern: Müller mit seiner Frau (Annemarie
Düringer) in SCHATTEN DER ENGEL]
Verglichen mit Filmen wie FAUSTRECHT DER FREIHEIT, BOLWIESER, SATANSBRATEN, LILI MARLEEN oder LOLA, widmet sich MST zwar durchgängig den Fassbinder-Themen, aber die Beziehungen sind hier doch schematisch zugespitzt. Auch enthält das Stück mit seinem elisabethanisch-jakobinischen Tonfall Elemente des barocken Trauerspiels50, die Fassbinder mit der diffizilen Form des Brechtschen Lehrstücks oder Modellstücks kombiniert, in dem die unmöglichen moralischen Dilemmata – die bekannten Double Binds – durchgespielt und ausgespielt werden51. Die zentralen Machtbeziehungen des Stücks zwischen Roma B. und Franz B., aber auch zwischen dem »Reichen Juden« und der Stadt funktionieren nach dem sadomasochistischen Modell – wobei beide dadurch kompliziert werden, dass sowohl der »Reiche Jude« als auch Roma B. gleichermaßen innerhalb und außerhalb der sie umgebenden Machtbeziehungen stehen. In einem Fall ist das Auseinanderklaffen von Bedürfnis des einen und Begehren des anderen bestimmend für die Figuren: Der Masochist Franz B. kommt dank der gotteslästerlichen, grotesken Bestrafung, die ihm widerfährt, auf seine Kosten. Roma B. will das kosmische Gleichgewicht durch ihren Opfertod wiederherstellen, doch dieser Tod ist sinnlos, weil die Stadt ihn zurückweist. Ihr Protestakt, der an die Gewissen appellieren will, wird zur bloßen bürokratischen Unbequemlichkeit. Im Falle des »Reichen Juden« dagegen ist es gerade die scheinbar so perfekte Übereinstimmung zwischen seinen Bedürfnissen und den Anforderungen der Stadt, die ihn zur tragischen Figur werden lässt und alle seine Anstrengungen – seien sie objektiv gut oder böse – absolut bedeutungslos macht.
Insofern will das Stück auch darin ein barockes Trauerspiel sein, dass es überall mit (metaphorischen) Spiegeln versehen ist, in denen sich die Charaktere fangen, wie in so vielen der Filme Fassbinders, nur sind die Spiegelbilder noch verzerrter. Strukturell weist MST eine große Nähe zu den als Spiegelkabinett konzipierten Filmen des Regisseurs auf, wie WELT AM DRAHT, CHINESISCHES ROULETTE und DIE DRITTE GENERATION, in denen die Machtdreiecke gleichermaßen verdoppelt, seitenverkehrt, miteinander verschränkt sind und einander dennoch dabei in Balance halten. Der Gelegenheitszuhälter und ewige Verlierer Franz B. ist oberflächlich dem »Reichen Juden«, der nie verlieren kann, entgegengesetzt, doch was sie verbindet, ist nicht nur, dass beide dieselbe Frau lieben, sondern auch, dass sie Werkzeuge und austauschbare Versatzstücke in den Ränkespielen der männlichen Gang sind, mit der sie konspirieren: Dass Franz B. das Double des »Reichen Juden« als (Nicht-)Mörder von Roma B. werden soll, ist deshalb gleich doppelt passend und erinnert an die narrative Logik, die auch LILI MARLEEN und LOLA zugrundeliegt, wo der Zufall die »falschen« Figuren an den »richtigen« Platz bringt. Während die Funktion der meisten sekundären Charaktere in MST darin besteht, die zentralen Beziehungen zwischen Franz B., Roma B. und dem »Reichen Juden« entweder zu verdoppeln oder umzukehren, entwickeln sich diese nach einem strikten Schema oder führen, wie bereits angedeutet, einen wechselseitigen, grausam-schönen pas de deux auf. Dies unterstreicht, dass man die Handlung wie ein Prisma drehen und auf unterschiedliche Weise betrachten kann – jedesmal produziert sie eine neue, überraschende Perspektive.
Zwei Formen des Antisemitismus sind im Stück einander gegenübergestellt: Müllers Antisemitismus ist zwar pathologisch und ein absoluter Antagonismus, aber ohne Hass und Ressentiment. Als Technokrat repräsentiert er die kalte, rationale Seite der Auslöschung – die Eichmanns und Mengeles: Gehirne, die den Genozid auf industriellem Niveau und mit der leidenschaftslosen Hingabe von Laborspezialisten planen und organisieren. Nun ist Müller ein Mann mit zwei Gesichtern, der seine Identität zwischen Tag und Nacht wechselt, aber seine Einstellung ist unverändert, reuelos und überzeugt. Gegen Müller, der die Wahrscheinlichkeit einräumt, die Eltern des »Reichen Juden« ermordet zu haben, kann man dessen nicht einmal ironisches Statement setzen: »Ein reizender Herr [...]. Fast könnte man vergessen, daß er Müller heißt«52. Damit wird das asymmetrische Spiegelverhältnis zwischen beiden Figuren unterstrichen, das eine der mysteriösen Machtquellen des »Reichen Juden« ist. Hans von Gluck repräsentiert die andere, hysterische Form des Antisemitismus, voller Hass und Vergnügen daran, hämisch gegenüber der imaginierten Macht des Juden und dessen Bestrafung: »Und ich reib mir die Hände, wenn ich mir vorstelle, wie ihm die Luft ausgeht in der Gaskammer.« In SCHATTEN DER ENGEL hält von Gluck seinen Monolog auf dem Bett liegend, wie in einem Fiebertraum, aber auf ihn trifft zu, was Henryk M. Broder einmal als »Antisemitismus wegen Auschwitz«53 charakterisiert hat.
Betrachtet man sie aus dem Blickwinkel des underdogs, weist die Figur des Franz B. zurück auf KATZELMACHER, schließt Fox aus FAUSTRECHT DER FREIHEIT ein und ist auch präsent in der Art und Weise, wie Kurt Raab den Bolwieser im gleichnamigen Film spielt. Aber mehr noch nimmt Franz B. Franz Biberkopf aus BERLIN ALEXANDERPLATZ vorweg, insbesondere den Franz Biberkopf des Epilogs »Mein Traum vom Traum des Franz Biberkopf«. Einer der typischen Einfälle des Stücks ist, dass Franz B. kein Antisemit ist (Juden interessieren ihn überhaupt nicht), sondern ein wütender Tennisgegner, der die Spieler mit einer irrationalen, aber unwiderstehlichen Leidenschaft hasst54.
Müllers Tochter Roma B. verweigert sich dieser intergenerationellen Verkettung der Suche nach Schuldzuweisung, Vergebung und Sühne: Sie geht aus ganz anderen Gründen mit dem Juden (zunächst, weil sie Franz B. liebt und dafür sorgen möchte, dass er sich vor seinen Kumpels als Mann fühlt). Als sie erfährt, dass sie als Pfand bei der Rache des »Reichen Juden« an ihrem Vater fungiert, reagiert sie gleichgültig, obschon sie genau weiß, dass hier ihr Heil liegen würde, weil es ein leichtes wäre, ihrem Leben »Sinn« zu verleihen, wenn sie sich für die Verbrechen des Vaters opferte55. Stattdessen können wir annehmen, dass Roma B., je tiefer sie in die Konfiguration Nazi/Jude hineingezogen wird, immer mehr auch die Beziehung Westdeutscher/Jude (nach Auschwitz, also im Schatten der Konfiguration Nazi/ Jude) lebt. Zudem kann man der Logik folgen, nach der sie, je mehr sie den Juden liebt, immer weniger selbst leben möchte. Wenn man Roma B. ins Zentrum des Stückes rückt, entsteht die Konstellation einer Frau, die erkennt, dass sie Teil eines Vertrages zwischen zwei »Vätern« ist, die sich darauf geeinigt haben, absolut uneins zu sein. Der Widerspruch nimmt ihr den Lebenswillen. Insofern er an die Figurenkonstellation Hermann – Oswald – Maria erinnert, wirft dieser Widerspruch auch ein neues Licht auf die zwiespältige Entscheidung der Titelfigur am Schluss von DIE EHE DER MARIA BRAUN.
Andererseits wird Roma B. auch durch das andere Dreieck Kraft entzogen, nämlich Franz B.s Vertrag mit Oskar von Leiden, einem sadomasochistischen Liebespakt. Die unterschiedlichen Dreiecke halten einander die Waage, werden aber auf divergierenden Ebenen formuliert: Das sexuelle wird dem antisemitischen entgegengesetzt; während das eine für das schmerzvolle Vergnügen steht, steht das andere für das schmerzvolle Missvergnügen. Wie schon im Falle von MARIA BRAUN und LOLA kann man erkennen, dass es hier darum geht, unterschiedliche Möglichkeiten von Figurenbeziehungen durchzuspielen, und in dieser Hinsicht (be)nutzt das Stück den »Reichen Juden« und den Antisemitismus als einander entsprechende Klischees einer vollständig entwürdigenden und erniedrigenden Form menschlicher Beziehungen. Dieser Nullpunkt ist notwendig, damit die zentrale Beziehung zwischen Roma B. und »A., genannt der Reiche Jude« sich entwickeln kann, das heißt, sich als Liebesgeschichte erkennen kann, die dadurch umso anrührender und tragischer wird, als sie sich zunächst allen irdischen Ballastes entledigen muss, um triumphieren zu können: Sie muss hinunter in die tiefsten Tiefen des Schmutzes, um leuchten zu können – wie so vieles in diesem Stück eine letztlich religiöse Konzeption von Körper, Liebe und Erlösung in sich trägt. Das wäre zumindest eine Lesart, die die Motivation der Figur der Roma B. klarer umreißen könnte. Wenn nämlich das Stück eine strukturelle Schwäche hat, dann liegt diese gewiss darin, dass Fassbinder es versäumte, die Figur soweit zu vertiefen, dass ein besseres Verständnis ihrer vita dolorosa möglich würde. In dieser Form nimmt sich ihr selbstmörderisches Sich-gehen-Lassen wie eine Mischung aus der unerbittlichen Abwärtsspirale in FAUSTRECHT DER FREIHEIT und den fiebrigen Panikattacken in DIE SEHNSUCHT DER VERONIKA VOSS aus. Auch in SCHATTEN DER ENGEL wird ihre Verzweiflung eher poetisch als dramatisch motiviert – durch die Zärtlichkeit der abschließenden tödlichen Umarmung, wenn Roma B. und der »Reiche Jude« gemeinsam den Tango der Selbstopferung tanzen.
Betrachtet man das Stück dagegen aus der Perspektive des »Reichen Juden«, erkennt man in der Figur sofort andere Charaktere aus Fassbinders Universum. Er ist ein Verwandter Oswalds aus DIE EHE DER MARIA BRAUN, und er verdient sein Geld in derselben Branche wie Schuckert, der Grundstücksspekulant in LOLA. Er ist die Spitze einer korrupten Machtstruktur wie Lenz in DIE DRITTE GENERATION, und er sitzt in der Mitte des Spinnennetzes wie der mysteriöse Vollmer in WELT AM DRAHT. Für den »Reichen Juden« sind zwei Verträge von Bedeutung: derjenige mit der Stadt, der ihn unantastbar macht, und derjenige mit Roma B., der ihn menschlich macht. Dass es sich bei letzterem um einen Rachevertrag handelt (mit einer Frau als Tauschobjekt!), scheint die Dynamik ihrer Beziehung nicht zu berühren. Entlang der (Nicht-)Bearbeitung der deutschen Vergangenheit ist der »Reiche Jude« die Wiederkehr des Verdrängten. Aber er ist auch jemand, der von den Toten auferstanden ist, und paradoxerweise – weil er sonst so anders ist als Schuckert, »das lebenslustige Schwein« – bleibt er der einzige, der in dieser Totenstadt Energie und Handlungsvermögen entwickelt. Wenn er denn, wie Hans von Gluck behauptet, ein Vampir ist, dann ist er kein Blutsauger, sondern vielmehr ein Racheengel, dessen bloße Präsenz die anderen an ihrer eigenen Schuld, ihrem Hass und ihren Ressentiments beinah ersticken lässt.
[Bild 4: Tango der Selbstopferung: Lily Brest und der »Reiche Jude«
(Klaus Löwitsch)]
Das wird auch der Grund sein, warum der »Reiche Jude« logischerweise keinen Namen haben kann. Als Brennpunkt all der Übel in der Stadt ist er ein Abbild, ein Surrogat dessen, was der deutsche Antisemitismus auf »den Juden« projiziert hat, seitdem die Krise der Moderne im ausgehenden 19. Jahrhundert die Juden zu der konspirativen Kraft machte, von der vermutet wurde, sie stecke gleichermaßen hinter Kapitalismus und Sozialismus. Der »Reiche Jude« weiß, dass er in den geborgten Klischees seiner Feinde spricht oder, psychoanalytischer gefasst, dass er von deren Sprache gesprochen wird – genau in dem Sinne, in dem Hans von Gluck formuliert: »Das ist kein Witz, so denkt es in mir«. Fassbinder hebt das hervor, wenn er betont: der »Jude ist der einzige in diesem Stück, [...] der imstande ist, die Sprache, in der er spricht, als ein Abkommen zwischen Leuten zu erkennen«56. Einen armen oder einen »guten« Juden zu zeigen, wie einige Kritiker angemahnt hatten, um dadurch das verbreitete antisemitische Klischee vom »reichen« Juden zu korrigieren, scheint insofern als absurder Vorschlag. Tatsächlich führte dies allenfalls zu einer anderen Form der Diskriminierung, indem man nämlich entweder sagt: »Antisemitismus ist okay, wenn er sich gegen politisch aktive Zionisten richtet« (eine Falle, in die einige der proarabischen Linken tappten), oder aber: »Ich habe nichts dagegen, Philosemit zu sein, aber dann kann ich auch erwarten, daß die Juden sich zu benehmen wissen«57. Es ist jedoch genau das Klischee vom »Reichen Juden«, das in Anschlag gebracht werden muss, um die phantasmagorische Figur zu packen, die den Antisemitismus nährt. Der »Jude« bei Fassbinder ist entindividualisiert aus Prinzip, weil das Stück, um Antisemitismus zu diskutieren, »den Juden« gerade so zeigen muss, wie er vom Durchschnittsbürger imaginiert wird – sei dieser nun ein offener Antisemit oder in einer Gesellschaft lebend und in einer Kultur aufgewachsen, die mit Antisemitismus »kontaminiert« ist (Broder), was auf manche der Debattierenden der 85er-Kontroverse zweifelsohne zutraf.
Man kann sich fragen, ob es nicht noch eine andere Perspektive gibt, von der aus sich das Stück als kohärent und lesbar erwiese: keine Figurenperspektive, sondern vielmehr die Perspektive der westdeutschen Gesellschaft und ihres repressiven Umgangs mit der (einstigen, uneingestandenen) Genugtuung oder (Schaden-)Freude, die der Nazismus und der Antisemitismus seinen Anhängern gewährte. Aus dieser Perspektive wäre das Stück nun um Müllers Gefolgsleute zentriert. Für sie – tagsüber bei der Stadtverwaltung tätig, nachts als homophobe Homosexuelle unterwegs – sind sowohl der »Reiche Jude« als auch Franz B. Außenseiter – insbesondere hinsichtlich dessen, was sie als Insider zusammenhält, nämlich Unterdrückung und Verleugnung der eigenen Gefühle, die in solcher Gesellschaft zum stärksten Band werden. Das Wissen um das Verbrechen, das Wissen um seine Verschleierung und die »Normalisierung«, die auf die erfolgreiche Verschleierung des Verbrechens folgt, fungiert als innerer Zement, während die gemeinsame Wut über die Schuld, die von außen auferlegt wird, zur Mauer wird, die gegen das eigene Gewissen feit. Zusammengenommen bezeichnen dieses Wissen um das Verbrechen und das sich Wappnen gegen die Schuld den fundamentalsten symbolischen Code, der von allen geteilt wird. Somit befasst sich Fassbinder nicht in erster Linie mit einem primären, »angeborenen« Antisemitismus, sondern vielmehr mit einem sekundären, reaktiven Post-Auschwitz-Antisemitismus, den Henryk M. Broder einmal als »Deutsch-Jüdisches-Gemeinschaftswerk« und Eike Geisel noch sarkastischer als »Familienzusammenführung« bezeichnet hat58.
Der Vorwurf, Fassbinders Stück sei antisemitisch, scheint mir also ebenso unhaltbar wie die Unterstellung, Fassbinder selbst sei ein Antisemit gewesen. Wenn es der Fall gewesen ist, dass das Stück einen latenten westdeutschen Antisemitismus, die »Wut der Täter auf die überlebenden Opfer« (Broder), aufstörte und verwirrend mit etwas zusammenbrachte, das den von Fassbinder zitierten Philosemitismus ausmacht, nämlich ein Antisemitismus, der Juden liebt, dann kann man mit Broder, Cohn-Bendit und anderen nur dankbar für die Gelegenheit sein (die Fassbinder Zeit seines Lebens nicht erleben durfte), diesen zentralen Aspekt deutschen Selbstverständnisses zur Diskussion zu stellen. Was Fassbinder tat, wäre dann nicht verwerflicher gewesen, als ein gefährlich aufgeladenes, aber frei flottierendes Hass-Idiom und einige drastische, aber legitime Techniken des Welttheaters dazu zu benutzen, der deutschen Öffentlichkeit, die er auf diese Weise zu erreichen hoffte, einen Spiegel vorzuhalten.
Das Anderssein des Anderen oder: »The Importance of Being Jewish«
Trotz alledem bleibt die Figur des »Reichen Juden« in MST problematisch, insbesondere wenn man sie als eine unter anderen jüdischen Figuren in Fassbinders Werk sieht: Deren Rollen und Funktionen fallen recht kompliziert und offen widersprüchlich aus. Man könnte sie unter drei Kategorien zusammenfassen: Zunächst sind »Juden« bei Fassbinder geeignete Projektionsflächen, die als archetypisch Andere in einer ganzen Spanne von Kontexten und Diskursen figurieren. Des Weiteren sind Fassbinders »Juden« Außenseiter, aber eher solche, die gelassen und unangreifbar außen sind, manchmal geduldig auf einen günstigen Moment wartend, manchmal auch bloß scheinbar unbeteiligt zusehend. Schließlich sind die »Juden« Figuren, in deren Gegenwart die Deutschen »die Wahl haben«: Sie nötigen den Deutschen zur Entscheidung, fordern ein Zeichen der Selbstreflexion, fungieren als Auslöser eines Entschlusses oder auch eines Umbruchs.
Man kann in diesem Kompositum eine Gestalt erkennen, von der nicht nur moralische Autorität oder magische Kräfte ausgehen, sondern die auch ein mythologisches Wesen außerhalb von Geschichte und Gesellschaft ist. Es ist sogar denkbar, dass es sich auch hier um Projektion handelt und eine ebenso phantasmatische und phantasmagorische Vorstellung entsteht wie das Jahrhunderte alte Bild »des Juden« in der antisemitischen Literatur und dem antisemitischen Denken. Um es etwas struktureller zu formulieren: Fassbinders »Jude« ist zunächst einmal, noch vor seiner religiösen oder rassischen Zugehörigkeit, die Figur des Anderen schlechthin, oder nach Jacques Lacan formuliert, er okkupiert den Platz des »Großen Anderen«. Dieser Platz ist nötig, damit Fassbinder den Mechanismus in Gang setzen kann, bei dem sich das Selbst durch den Anderen definiert und Identität nur aus der Identifikation mit dem Anderen entsteht. Da dieser bei Fassbinder aber als Antagonist erscheint, ist die Rolle des »Juden« notgedrungen antagonistisch, denn er spiegelt den unterdrückten, unbewussten Teil des Selbst, an den die Identität unwiderruflich gekoppelt ist. Fassbinder spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer zweiten »Erbsünde«:
»[N]icht allein durch die Zeit von 33 bis 45 [...] ist die Geschichte der Deutschen und der Juden auf alle Zeit miteinander verknüpft, so etwas wie eine neue andere Erbsünde wird sich in den Menschen verfestigen, die in Deutschland geboren oder leben werden, eine Erbsünde, die nicht etwa dadurch von geringer Wichtigkeit wäre, weil die Söhne der Mörder sich heute die Hände in Unschuld waschen«59.
Problematisch an dieser Konzeption der Juden ist, dass sie zwar nicht in dem Maße entmenschlicht werden, wie es durch antisemitische Klischees geschieht, doch werden auch hier ihre individuellen Geschichten und Schicksale entpersonalisiert, und zwar auch diejenigen, die mit dem sowieso schon generalisierenden Begriff »Auschwitz« verknüpft sind. In der Anlage der Figur des »Reichen Juden« ist also der Konflikt vorprogrammiert, denn das persönliche, politische und historische Material zu seiner Geschichte exisitiert – nur wird es eben nicht im Stück präsentiert. Weil der »Reiche Jude« als Projektionsfigur so angelegt ist, dass er explizit die Mechanismen vorführt, wie der/das Andere entsteht, verhält er sich bei Fassbinder nicht passiv. Er setzt seinerseits die auf ihn projizierte Macht – die paranoide Macht eines Phantasmas, gleichzeitig mythisch, ökonomisch und sexuell – als Kapital im umfassendsten Sinn ein: als physische Bedingung des Überlebens (»De[n] Profit, den ich brauche, um mir das leisten zu können, was ich brauche.«) und als symbolische Währung in seiner Beziehung zur Gesellschaft (er ist selbst für das Gesetz unantastbar). Aber was wäre, wenn Juden sich in diesem Bild nicht wiedererkennen, oder besser gesagt, wenn sie sich weigerten, ein derart entfaltetes »Anderssein« als Kategorie zu akzeptieren, mittels derer sie sich identifizieren wollen oder können? Genau letzteres geschah im Falle von MST, weil weder der mutmaßlich mit dem »Reichen Juden« Gemeinte noch die Jüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik (oder auch in Frankreich und den Niederlanden)60 bereit waren, »Anderssein« als ihr bestimmendes Merkmal zu akzeptieren. Seyla Benhabib hat dieses Dilemma prägnant beschrieben:
»Während ein Daniel Cohn-Bendit sich problemlos mit den Juden identifizieren und sich mit ihnen solidarisieren kann – gerade weil sie in diesem Fall Außenseiter sind –, finden die im Nachkriegsdeutschland lebenden Juden die Gesellschaft, in die Fassbinder sie steckte, abstoßend. Ein weiteres Mal sehen sie sich als ›das Andere‹ identifiziert – und dieses Anderssein [...] ist bedrohlich. Mit anderen Worten: Ein Cohn-Bendit kann die politische Botschaft und die politische Gemeinschaft, in die Fassbinder ihn gestellt hat, akzeptieren, weil er in diesem Anderssein ein Moment der Erlösung zu erkennen vermag, während die Jüdische Gemeinde in der Bundesrepublik, die sich in der Nachkriegszeit um Respekt bemüht und diesen auch erhalten hatte, versuchte, gerade dieses Anderssein hinter sich zu lassen.« 61
Mit einer solchen Position verändert sich die Grundlage der Debatte, indem Antisemitismus in einen größeren Zusammenhang, den wir heute meist mit dem Begriff »Identitätspolitik« belegen, gestellt wird. Dieser umfasst die Frage nach den Beziehungen zwischen Minderheiten und Mehrheiten und auch zwischen den Geschlechtern, also ganz allgemein Dynamiken der Unterdrückung, wo Außenseiter oder Opfer um kulturelle und/oder politische Repräsentation kämpfen. Dies mag ebenfalls unbefriedigend erscheinen, zumal die Jüdische Gemeinde zu Recht auf der Einzigartigkeit des Holocaust besteht und damit zugleich auf der historischen Tatsache, dass dieser in Deutschland von deutschen Tätern ins Werk gesetzt wurde, während sie sich gleichzeitig für Gleichberechtigung als Grundbedingung ihrer Existenz als Deutsche in Deutschland einsetzt.
Was Fassbinder betrifft, ist anzunehmen, dass er die jüdische Frage in den meisten Fällen analog zu der anderer Minderheiten verstand. Seine jüdischen Charaktere schreiben sich in den weiteren Rahmen der Filme ein, die der Repräsentation von Minderheiten gewidmet sind. Fassbinder hat stets darauf bestanden, dass er es prinzipiell vermied, von Minderheiten oder Opfern der Gesellschaft positive Bilder zu zeichnen, weil dies bloß eine andere, kaum subtilere Form der Diskriminierung sei. Er war sich der Möglichkeit bewusst, dass selbst mythische Repräsentationen – ihrerseits »positive« Bilder in dem Sinne, dass sie mit Energie aufgeladen sind – diskriminierend wirken können:
»Mich des Antisemitismus zu beschuldigen, ist bloß eine Ausrede, denn im Grunde wollte ich ja zeigen, wie der Antisemitismus entstanden ist. [...] Ich finde es nicht antisemitisch zu erzählen, welche Fehler ein Jude begehen mußte, um überhaupt überleben zu können. Am besten läßt sich doch die Unterdrückung einer Minderheit beschreiben, indem man zeigt, zu welchen Fehlern und Untaten die Mitglieder einer Minderheit als Konsequenz der Unterdrückung gezwungen werden.« 62
Wenn also Fassbinder darauf verzichtete, jemanden, nur weil er einer Minderheit angehört, in einem vorteilhaften Licht erscheinen zu lassen, so heißt das nicht, dass er »Opfer« nie so darstellte, wie sie sich selbst sahen. Aber auch in diesen Fällen zeigte er deren Identität als Effekt der Einbindung in vorgegebene Schema, das heißt, er ließ die Inkongruenz zwischen dem Selbstbild und dem Bild, das sich andere von einem machen, immer durchscheinen63.
Die Nicht-Darstellbarkeit des Juden
Ähnlich wie Seyla Benhabib, wenngleich aus einer polemischeren Position, hat Gertrud Koch argumentiert, dass Fassbinder in die antisemitische Falle getappt sei, weil sein »Jude« – selbst wenn man den Regisseur beim Wort nimmt – nicht nur »anders«, sondern ausnahmslos allegorisch konzipiert sei. So erscheine »der Jude« als notwendigerweise nicht– assimilierbare Figur in einer Allegorie, die mit dem Tod und der Abtötung des Fleisches assoziiert wird, was im moralischen und bildlichen Kosmos Fassbinders durchaus eine spezifische Bedeutung habe. In ihrem aufschlussreichen Essay berührt Koch eine Problematik, die auch hier immer wieder zur Debatte steht, nämlich die des besonderen Status eines Fassbinder-Films als »Text« – realistisch, metaphorisch-rückbezüglich, allegorisch oder als Form, die zwischen verschiedenen Bezügen oszilliert. Indem sie die allegorisierenden Verfahren Fassbinders analysiert, kommt Koch zu dem Ergebnis, dass die »jüdischen« Figuren in der Reihe der Opfer der Gesellschaft und der Außenseiter keinen Platz finden und dass aus diesem Grund Fassbinders eigenes Plädoyer bezüglich seiner auf Minderheiten bezogenen identity-politics in diesem Fall nicht zutrifft. Für Koch stellen Fassbinders Allegorisierungen der als jüdisch ausgewiesenen Personen in Filmen wie IN EINEM JAHR MIT 13 MONDEN, BERLIN ALEXANDERPLATZ und DIE SEHNSUCHT DER VERONIKA VOSS eine klischeehafte Konzeption des Juden als Opfer-Figur dar. Aber Fassbinder setze auch eine Verschiebung in Gang, nämlich »die Verschiebung der Opfer-Phantasien von den Juden weg zu denjenigen Figuren, die [...] prädestiniert sind zum Leiden am Leib, zur Qual des Fleisches«64. So werden die jüdischen Figuren zu Objekten des Begehrens, allen voran Anton Saitz, ein Überlebender der KZs, für den Erwin/Elvira in IN EINEM JAHR MIT 13 MONDEN bereit ist, mehr als ihr Leben zu verändern.
Mit anderen Worten: Für Koch ist die Darstellung der Juden innerhalb der Fantasiestruktur der Filme Fassbinders dadurch charakterisiert, dass sie zwar einerseits zu Selbstopferungswünschen Anlass geben65, dass aber andererseits der Preis, den die Juden dafür zahlen, darin besteht, in eine Art mythisches Universum verbannt und aus der Zeitgeschichte entlassen zu werden. In einer anderen, komplementären Bewegung werden sie zu strengen, patriarchalen Figuren kalter Intellektualität, ausgeschlossen von der leidenden, gequälten Leiblichkeit, die in Fassbinders sadomasochistischem Kosmos Zeugnis von Lust, Leben und Tod ablegt.
Kochs Überlegungen sind ihrerseits den Reflexionen Saul Friedländers zum »neuen Diskurs« über den Nazismus verpflichtet, für den Fassbinders Arbeiten – nach Friedländers Meinung – symptomatisch sind. Dieser Diskurs überführt den Nazismus, seine Ikonografie und seine Machtfantasien in eine »Mythologie«, löst ihn damit nicht nur aus der Geschichte, sondern öffnet ihn für alle Formen der libidinösen Besetzung, vom Pornografischen zum Politischen durch Kitsch, Nostalgie und einen nihilistischen Todeskult. Der den Überlegungen Friedländers und Kochs inhärente Fluchtpunkt, vielleicht am pointiertesten von Eric Santner formuliert66, ist die Forderung, Juden als Subjekte darzustellen, während ein Künstler wie Fassbinder, wiewohl politisch der Linken zugehörig, nicht umhin kann, seine Bilder »der Juden« zu objektivieren, zu allegorisieren und zu mythologisieren.
Damit geht es also nicht so sehr darum, ob die Juden als »das Andere« repräsentiert sind oder nicht, als vielmehr um ihre grundsätzliche Nicht-Darstellbarkeit. Dieser Problemkomplex einer prinzipiellen Nicht-Darstellbarkeit der Juden in der deutschen Nachkriegsgesellschaft wiederholt in vielem die Debatte um die Nicht-Darstellbarkeit von Auschwitz. Tatsächlich könnte die ganze Frankfurt-Episode in Begriffe der »Grenzen der Repräsentation«67 umgeschrieben werden, als Teil einer Diskussion, die Realisten und Allegoriker, Dokumentaristen und Fiktionalisten einander gegenüberstellte. Der Forderung nach positiven Rollenmodellen sind wir bereits begegnet: In diesem Fall würde dies implizieren, den »Reichen Juden« durch einen »guten Juden« aufzufangen, womit der Auseinandersetzung über den Signifikanten »Jude« als zugleich einzigartig und universell ein allzu gefälliger Kompromiss zu Hilfe käme. So wie ein unterstellter Universalismus den Weg hin zu einer Historisierung, Normalisierung und auch einer Relativierung des Holocaust öffnete, so leicht träte das Einzelschicksal, sei es das der Anne Frank oder das der (fiktiven) Familie Weiss in HOLOCAUST, an die Stelle des Schicksals der sechs Millionen ermordeten Juden, wobei das Angebot zur Identifikation zugleich das Risiko der Trivialisierung birgt. In all diesen Fällen wird klar, dass es einen »normalen Juden« – außer vielleicht in Israel – nicht geben kann, denn dann wäre die Tatsache, dass er Jude ist, nicht länger eine Tatsache der politischen, ethischen oder historischen Diskurse, sondern lediglich eine anekdotische Tatsache der Religion oder der Herkunft eines bestimmten Individuums. Die Argumentation scheint in der Tat zirkulär, weil sie uns mit dem Dilemma, dem Teufelskreis alleinlässt: Ist es möglich, das Zeichen »Jude« in einem Diskurs über Deutschland zu verwenden, ohne Zuflucht zu der Figur des »Anderen« zu nehmen? Für dieses Dilemma bot Fassbinder im Stück seine Antwort an, derart eklatant formuliert, dass sie scharfsinnigen Interpreten unmittelbar als zentral auffallen musste68, nämlich Hans von Glucks schockierende und schockierend enthüllende Sentenz: »Sie haben vergessen, ihn zu vergasen. Das ist kein Witz, so denkt es in mir.« Ein Satz, der den Subjekteffekt betont, der gleichermaßen durch Rassismus und Sprache produziert wird.
Dieser Satz macht explizit, was implizit blieb in der Aufspaltung der Figuren, die ihre Double Binds entäußerten, wie Johanna in GÖTTER DER PEST, oder die sie »lebten«, indem sie sie wortwörtlich nahmen, wie Hans in HÄNDLER DER VIER JAHRESZEITEN. Deutlicher als jede Figur des Stücks spricht der Satz vom Unterschied zwischen dem Sagen und dem Gesagten, zwischen der Äußerung und ihrer Bedeutung. Er kann sogar als Kommentar auf all jene, vor allem öffentliche Anlässe gelesen werden, bei denen diese Aufspaltung – wenn es um das deutschjüdische Verhältnis ging – mühsam und zumeist vergeblich unterdrückt wurde. Es scheint, als ob die bundesdeutsche Identitätspolitik der siebziger und achtziger Jahre genau von dieser doppelten Bewegung geprägt worden ist: Ein öffentlich vertretener Antifaschismus und Philosemitismus hatte sich nicht nur mit dem eigenen Unterbewusstsein (Subjektposition) auseinanderzusetzen, sondern auch mit der Überlegung, wer über was wann zu wem spricht (die eigene Sprecherposition). Öffentliche Feierlichkeiten, seien sie historischer Erinnerung oder anderen Anlässen gewidmet, erwiesen sich als besonders verräterisch, wie beispielsweise der bereits erwähnte 8. Mai 1945, das Datum der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches. Die Pannen und Missverständnisse, die sich in den vergangenen fünfzig Jahren rund um dieses Datum ereignet haben, füllen ein ganzes Buch69, das die Unfähigkeit der Bundesrepublik dokumentiert, darüber Einverständnis zu erlangen, ob man jetzt die Befreiung feiert, die totale Niederlage betrauert oder beides oder nichts von beidem. Die Kette reicht bis zu Kanzler Kohls vergeblichem Versuch, diesen gordischen Knoten durchzuschlagen, indem er den amerikanischen Präsidenten Reagan nach Bitburg einlud, um ein Ereignis zu schaffen, bei dem Deutsche und Amerikaner sich darauf einigen konnten, zumindest immer schon Verbündete im Kampf gegen den Kommunismus gewesen zu sein.
Der 8. Mai ist nicht das einzige Beispiel dafür, dass in der westdeutschen Öffentlichkeit die Geschichte als Wiederkehr des Verdrängten plötzlich intervenierte, um eine unerwünschte Aufmerksamkeit auf die Sprecherposition prominenter Deutscher zu lenken. Am 9. November 1988 fand in Bonn eine Gedenkveranstaltung zum fünfzigsten Jahrestag der sogenannten »Reichskristallnacht«, dem Beginn der offenen, staatlich gelenkten Verfolgung der Juden, statt. Bundestagspräsident Philipp Jenninger hielt bei diesem Anlass eine programmatische Rede, die soviel Fassungslosigkeit hervorrief, dass er sich in der Folge genötigt sah, von seinem Amt zurückzutreten. Wenn man diese Rede in der gedruckten Fassung liest, ist man von der tiefen, emotionalen Identifikation des Redners/Verfassers mit den Opfern betroffen, insbesondere bei den Passagen, in denen er ausführlich und voll schrecklicher Details einen Augenzeugenbericht von einer Massenexekution zitiert. Aber da er als Deutscher und nicht als Jude spricht, versucht er auch, sich in die Gedanken eines »normalen« Deutschen des Jahres 1938 hineinzuversetzen. Jenningers Rede kann man als einen Post-HOLOCAUST- und Post-HEIMAT-Versuch einer Rede charakterisieren, die sich gleichzeitig an zwei einander ausschließende Adressaten richtet: Deutsche und Juden, in Erinnerung an jene, die in Orten wie Schabbach lebten, dem fiktiven Dorf, in dem Reitz’ HEIMAT spielt, und im Gedenken an diejenigen, die in die Lager transportiert wurden. Dieser Versuch schlug auf einzigartige Weise fehl, nicht nur, weil kein historischer Diskurs existiert, in dem diese beiden Realitäten als vergleichbare Subjektpositionen koexistieren könnten, sondern auch, weil Jenninger seine eigene Sprecherposition fatal missverstanden hatte. Was möglicherweise als gesprochener Text eines von Verantwortungsbewusstsein und dem Wunsch nach Sühne bewegten Individuums durchgegangen wäre, konnte vom Repräsentanten der höchsten gewählten Körperschaft des Staates so nicht formuliert werden. Repräsentation besaß hier seine volle Bedeutung, nämlich ein Ereignis zu repräsentieren und auch in Vertretung von jemandem zu sprechen. Und diejenigen, für die Jenninger sprach, hatten gewiss nicht diese Art der Repräsentation erwartet70. Mit seinem Versuch, den jeweiligen Rahmen zweier inkompatibler Diskurse – den der Täter und den der Opfer – aufzuheben und daraus einen einzigen (und einigenden?) Diskurs der Betroffenheit zu konstruieren, begab sich Jenninger in eine Position, von der aus er gar nichts mehr zu sagen hatte. Seitdem ist die sogenannte »Reichskristallnacht« in einer erneuten historischen Wendung ein weiteres Mal zu einem überdeterminierten Datum geworden, bei dem zwei völlig unterschiedliche Ereignisse und ihre jeweiligen Echos einander überlagern und sich gegenseitig abdämpfen, wenn nicht gar zum Schweigen bringen71.
Bei solchen Gelegenheiten »überwältigt« die Geschichte auch sorgfältig formulierte Sprecherpositionen, so dass die »Bewältigung« der Vergangenheit offenbar auch eine Nicht-Beherrschung der Geschichte mit einschließt, das heißt, man muss die »Fehlleistungen« akzeptieren können, ehe man sich als Repräsentant Deutschlands eine Sprecherposition zu eigen machen kann72. Eine ähnliche historische Semiotik der Parapraxen konnte man überall in Mittel- und Osteuropa nach 1989 am Werk sehen. Sie übersteigt Individuen und Texte und schließt beispielsweise die Art und Weise ein, in der »Es« in einer Nation über die eigene Geschichte in Form offizieller Feier- oder Gedenktage, beim Benennen von Straßen und Plätzen als Orte nationaler Geschichte »spricht«. Gewiss war es kein Zufall, dass Jürgen Habermas zu Beginn der Polemik, die später zum »Historikerstreit« werden sollte, eine Beziehung zwischen den Schriften eines Ernst Nolte und den Regierungsplänen für zwei neue historische Museen erkannte (eines in Bonn für die Geschichte der Bundesrepublik, eines in Berlin für die deutsche Geschichte), obwohl Nolte an diesen Entscheidungen gar nicht beteiligt war. Dank des unvorhergesehenen Falls der Berliner Mauer und der deutschen Vereinigung erwies sich dieser weitere Versuch Helmut Kohls, die deutsche Geschichte strategisch zu verteilen und damit asymmetrisch aufzuteilen, als voreilig.
Ebensowenig war es ein Zufall, dass der Text, den Habermas zum Anlass seiner Intervention nahm, eine vergleichbare duale Struktur aufwies. Andreas Hillgrubers Zweierlei Untergang vereinigt in einem Band einen Aufsatz zur »Zerschlagung des Deutschen Reiches« und einen Aufsatz zum »Ende des europäischen Judentums«73. Diese so unterschiedlich zu gewichtenden Ereignisse schienen hier in ein- und denselben diskursiven Raum gezwängt, und was bislang von Historikern säuberlich getrennt war, stand plötzlich nebeneinander, vielleicht in der Hoffnung, wieder zu einer integralen Darstellung der jüngeren deutschen Geschichte zu gelangen. Hillgruber verband implizit die Geschichte des Zusammenbruchs der Ostfront 1944/45 und die »Endlösung«, ihre Planung und unbarmherzige Umsetzung 1942–45 zu einer irreführenden und, wie sich zeigen sollte, provokanten Symmetrie. Die Provokation steckte weniger im Ton der Texte oder in den dargestellten Tatsachen74. Problematisch war vor allem die Parallelisierung, die im bloßen Nebeneinanderstellen der Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Ostprovinzen und der Vernichtung der Juden, die aus ganz Europa in Lager zusammengetrieben worden waren, angelegt war. Die größte Verärgerung allerdings löste Hillgrubers offenes Eingeständnis aus, dass er als deutscher Historiker nicht umhin könne, von der Ungerechtigkeit gegen die deutsche Bevölkerung, ihrem Leiden und Sterben während der kalten Wintermonate 1944/45 zutiefst betroffen zu sein. Hätte Hillgruber, der selbst zu den Vertriebenen zählte, diese Bemerkungen in einem biografischen Zusammenhang gemacht, hätte es wenig Aufregung gegeben, wie der Historiker Perry Anderson zutreffend angemerkt hat. Aber indem er als deutscher Historiker diese Betroffenheit und Identifikation formulierte, »rutschte [Hillgruber] mit einem Schritt vom Verständlichen ins Untragbare«75. Ein Grund für diese Untragbarkeit ist besonders offensichtlich: Durch seine Position der Betroffenheit schafft Hillgruber in einem Erzählraum zwei Arten von Opfern, die miteinander konkurrieren, auf der einen Seite die Opfer des Holocaust, deren einzigartiges und mahnendes Schicksal dadurch fast aufgehoben wird, dass sie sich auf der anderen Seite mit den zivilen Opfern der tatsächlichen oder angenommenen sowjetischen Vergeltungsmaßnahmen in den Ostprovinzen verglichen sahen.
Gewiss könnte man einwenden, dass auch den Deutschen das Recht zur Trauer um ihre Toten eingeräumt werden müsse. Man könnte Hillgruber auch in dem Sinne verstehen, dass er dem Ratschlag der Mitscherlichs gefolgt sei, demzufolge die Nachkriegsdeutschen unter einer Art Selbstentfremdung litten, weil ihre »Unfähigkeit zu trauern« auch ihre Liebesfähigkeit beschädigt habe: Sie könnten nicht lieben, weder sich selbst noch andere, so dass erst die Trauer über die eigenen Toten der Anteilnahme und Reue den Weg freilege76. Aber auch diese »Trauerarbeit« ist keineswegs unpolitisch und birgt, wie die Beispiele von Syberberg bis Hillgruber zeigen, große Risiken in sich. Manchmal, so scheint es, bleibt »Trauerarbeit« in Selbstmitleid und Sentimentalität stecken. »Was an den Deutschen so schrecklich ist, ist nicht ihre Brutalität, sondern ihre Sentimentalität«, hat der jüdische Autor Amos Oz einmal angemerkt. Man leistet sich Mitleid lediglich um den Preis eines Aufrechnens der Opfer. Wie bereits im Kapitel zu DIE EHE DER MARIA BRAUN angesprochen, werfen viele Produktionen des Neuen Deutschen Films einen Blick auf die deutsche Geschichte, in dem Deutschland als Nation von Opfern erscheint: entweder indem Frauen als Protagonisten die Handlung (er)tragen oder indem das Land selbst als weiblicher Körper allegorisiert wird – verletzbar und misshandelt. In beiden Fällen erschien es vor allem ausländischen Kritikern fast wie ein Wettbewerb um den Opferstatus77. Aber wenn selbst »Trauerarbeit« keine Bewegung auf den »Anderen« hin erlaubt, was bleibt dann zu tun? Welche Art von »Arbeit an den Gefühlen« vermag Melancholie und Apathie zu lösen, was kann Erinnerung und Hoffnung versöhnen, Erfahrung vor dem Vergessen bewahren oder zwischen Selbstmitleid, defensiver Aggression und Scham vermitteln? Fassbinder hatte mit seinem provozierenden Stück MST begonnen, über dieses Problem in einer ungewöhnlichen und unorthodoxen Weise laut nachzudenken, so dass der ethische und emotionale Standpunkt, von dem aus seine Figuren in ihrer Zerrissenheit und Widersprüchlichkeit sprachen, jenen Raum deutlich überschritt, der in der bundesdeutschen Öffentlichkeit (oder auf der Frankfurter Bühne) hierfür vorgesehen war. Vielleicht konnte Fassbinder nur im Kino und im Medium Film seine eigene Repräsentanz und die Positionen seiner Figuren vollständig kontrollieren.
Notes
Serge Daney: Auf Wiedersehen, Veronika. In: Libération, 1.7.1982, S. 23.
Der dokumentarische Kompilationsfilm HITLER – EINE KARRIERE (1977; R: Joachim C. Fest und Christian Herrendoerfer) widmet ganze drei seiner 96 Minuten der Nazipolitik gegenüber den Juden und den Konzentrationslagern.
Selbst heute ist der deutsche Prä-Auschwitz-Antisemitismus ein umstrittenes Feld. Vergleiche hierzu die hitzige Debatte um Daniel Goldhagens Buch Hitlers willige Vollstrecker. Berlin: Siedler 1996.
Das Holocaust-Mahnmal von Alfred Hrdlicka, das am Hamburger Dammtor-Bahnhof stand, sorgte jahrelang für Proteste, bevor es schließlich entfernt wurde.
Primo Levi: Die Atempause. München: dtv 1995 (2. Aufl.), S. 242.
Hermann Glaser: Die Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland: Zwischen Protest und Anpassung. Frankfurt/Main: Fischer 1990, S. 342.
Vergleiche Moishe Postone: Anti-Semitism and National Socialism. In: New German Critique, Nr. 19, Winter 1980, S. 98: »The emphasis on anti-Semitism has served to underline the supposed total character of the break between the Third Reich and the Federal Republic, and to avoid a confrontation with the social and structural reality of National Socialism, a reality which did not completely vanish in 1945.«
Fassbinder 1986, S. 82.
Jörg Friedrich: Die kalte Amnestie. Zitiert in: Glaser (siehe Anm. 6), S. 343.
Ralph Giordano: Die zweite Schuld oder Von der Last Deutscher zu sein. Hamburg: Claasen 1987, S. 11.
Vergleiche Anm. 77 und auch Neil Ascherson: The Cost of Bitburg. In: N.A.: Games with Shadows. London: Century Hutchinson 1988, S. 168ff.
Vergleiche Postone (siehe Anm. 7), S. 98: »Mit anderen Worten: Was mit den Juden geschah, wurde instrumentalisiert und transformiert in eine Legitimationsideologie für das gegenwärtige System. Dies war möglich, weil Antisemitismus in erster Linie als eine Form von Vorurteil, als Sündenbock-Ideologie, betrachtet wurde. Eine Einschätzung, die den Blick auf die inhärenten Beziehungen zwischen dem Antisemitismus und anderen Aspekten des Nationalsozialismus verstellte.«
Eine vorzügliche Zusammenstellung der Debatten und Positionen bis zum Ende der siebziger Jahre finden sich in: New German Critique: Germans and Jews, Nr. 19, 20, 21, Winter/Frühjahr 1980–Herbst 1980.
Unter den Büchern, die sich ein weiteres Mal um den Zusammenhang von Ressentiment und Antisemitismus, diesmal eher unter Gender-Aspekten, bemühten, ist besonders wichtig: Klaus Theweleit: Männerphantasien. Bd. 1 und 2. Reinbek: Rowohlt 1980 (Original: Frankfurt/Main: Stroemfeld / Roter Stern 1978).
Michael Geisler: The Disposal of Memory: Fascism and the Holocaust on West German Television. In: Murray/Wickham 1992, S. 220ff.
Zitiert von Henryk M. Broder: Antisemitismus – ja, bitte. In: Süddeutsche Zeitung, 18.1.1986 (Wiederabdruck in: Lichtenstein 1986, S. 213).
Broder beschreibt dies als »die Wut der Täter auf die überlebenden Opfer, deren Existenz eine schwer erträgliche Provokation ist [...].«
Neil Ascherson: Vortrag am Goethe Institut London, gehalten am 20. Februar 1990 (Mitschrift).
Vergleiche hierzu Gehabtes Sollen – gesolltes Haben. In: Fassbinder 1984, 36ff.
Eine Einschätzung von Peter Chatel zitiert nach: Raab/Peters 1982, S. 292. Demgegenüber hat Daniel Schmid berichtet, Fassbinder habe das Stück während eines Fluges von Frankfurt nach Dakar geschrieben und nicht so sehr aus Ärger über Frankfurt, sondern vielmehr, um dem TAT-Team zu zeigen, wie schnell er arbeiten könne. Vergleiche Katz 1987, S. 100. Holger Fuß dagegen berichtet, dass Fassbinder hauptsächlich daran interessiert war, Zwerenz’ Roman mit großem Budget zu verfilmen. Das Stück, eine »komprimierte Szenen-Collage«, sei lediglich ein »Nebenprodukt des eigentlichen filmischen Großprojektes.« Holger Fuß: Sind Juden niemals böse? In: Lichtenstein 1986, S. 71ff., Zitat S. 72. Chatel dagegen geht davon aus, dass das Stück für Fassbinder sehr wichtig war. Vergleiche Raab/Peters 1982, S. 292.
Fest war durch eine Rezension in der Frankfurter Rundschau alarmiert worden. Ursprünglich sollte der Text im Suhrkamp Verlag in einer Sammlung der Stücke Fassbinders erscheinen, doch der Band wurde nicht ausgeliefert und eingestampft. Joachim C. Fest: Reicher Jude von links. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.3.1976. Vergleiche auch New German Critique, Nr. 38, Frühjahr/Sommer 1986, Special Issue: The German-Jewish Controversy. Obwohl sich der Band auf die Kontroverse vom Herbst 1985 konzentriert, bietet er auch Material zur Debatte von 1976. Beide Kontroversen sind (fast) lückenlos dokumentiert in Lichtenstein 1986.
Nach Fassbinders Aussage hatte das Stück seinen Zweck erfüllt, als er und Daniel Schmid SCHATTEN DER ENGEL fertiggestellt hatten. Einen Grund für andere, das Stück im Theater zu inszenieren, sah er nicht. Vergleiche Fassbinder 1986, S. 68, 75. Fassbinder wollte Zwerenz’ Roman immer verfilmen, fand aber die Mittel nicht. Vergleiche ebenda, S. 160. Zwerenz überarbeitete seinen Roman und publizierte ihn zusammen mit dem Drehbuch 1986. Vergleiche seine Anmerkungen in Gerhard Zwerenz: Der langsame Tod des Rainer Werner Fassbinder. München: Schneekluth 1982.
Kaes 1987, S. 92: »[Fassbinders] Versuche, tief ins Zentrum der empfindlichsten Tabuzonen der Bundesrepublik vorzudringen – die Erinnerung an Antisemitismus und den industriell geplanten und durchgeführten Völkermord – sind allesamt gescheitert.«
Katz 1987, S. 95.
Joachim Fest: Zensur für Fassbinder. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.7.1985, zitiert nach: Lichtenstein, S. 62.
Jürgen Habermas: Eine Art Schadensabwicklung. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1987 (Kleine Politische Schriften IV).
Der Hintergrund der Bitburg-Kontroverse wird ausführlich entwickelt in: Geoffrey Hartmann (Hg.): Bitburg in Moral and Political Perspective. Bloomington: Indiana University Press 1986.
28 Ein Auszug der Rede erschien in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.10.1985 (Wiederabdruck in: Lichtenstein 1986, S. 77).
»[D]eswegen wurden Untersuchungen über latenten oder manifesten Antisemitismus, wie etwa die von Alphons Silbermann, von keiner Seite so entschieden zurückgewiesen und als ›fragwürdig‹ abqualifiziert wie von den Repräsentanten des jüdischen Zentralrats. Der trieb, so Silbermann, eine ›Vogel-Strauß-Politik‹ und tat, als wäre alles in bester Ordnung, solange deutsche Spitzenpolitiker zur Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit feierliche Reden hielten.« Henryk M. Broder in: Lichtenstein 1986, S. 212.
Wertvolles Material findet sich in der Mitschrift eines Symposions zu diesem Thema mit Beiträgen von Andrej S. Markovits, Seyla Benhabib und Moishe Postone: R.W. Fassbinder’s GARBAGE, CITY AND DEATH: Renewed Anatagonisms. In: New German Critique, Nr. 38 (siehe Anm. 21), S. 3ff.
Andrej S. Markovitz: R.W. Fassbinder’s GARBAGE, CITY AND DEATH. Ebenda, S.10.
Fassbinder 1991, S. 675.
Ebenda, S. 696.
Jean Améry: Shylock, der Kitsch und die Gefahr. In: Die Zeit, 9.4.1976 (Wiederabdruck in: Lichtenstein 1986, S. 40ff.): »[Fassbinder] ist [...] ein psychologieverlassener, unphilosophischer und unhistorischer Mensch.«
Hellmuth Karasek: Shylock in Frankfurt. In: Der Spiegel, 15/1976 (Wiederabdruck in: Lichtenstein 1986, S. 35).
Gerhard Zwerenz: Politik mit Vorurteilen. In: Vorwärts, 22.2.1986 (Wiederabdruck in: Lichtenstein 1986, S. 243ff.).
Karasek (siehe Anm. 35) (Wiederabdruck in: Lichtenstein 1986, 40ff.): »Auch wenn Zwerenz und Fassbinder das sicher nicht wünschten – woher wollen sie wissen, daß man sich aus ihrem ›reichen Juden‹ nicht auch ein Alibi für unverdaute mörderische Vorurteile zurechtschneidert?« (Lichtenstein 1986, S. 36). Peter Zadek hat dagegen festgestellt: »Natürlich ist [das Stück] antisemitisch, das merkt jeder, der es liest. Gerade deswegen muß es aufgeführt werden. Ich bin sicher, daß heute in Deutschland ein Theaterpublikum objektiv genug denken kann, um zu sehen, daß ihm ein Stück stürmerartiger Antisemitismus vorgeführt wird.« (Leserbrief in: Die Zeit, 13.9.1985).
New German Critique, Nr. 38 (siehe Anm. 21), S. 20, und Lichtenstein 1986, S. 83.
Vergleiche Fassbinder 1986, S. 168: »Egal, was ich mache [...] – die Leute regen sich auf.«
Ebenda, S. 82ff.
Reinhold Grimm: The Jew, the Playwright and Trash. In: Monatshefte, 81/3, 1991, S. 26.
Fassbinder 1991, S. 702.
Fassbinder 1986, S. 98f.
Zu Fassbinders Abneigung gegen das Theater vergleiche Juliane Lorenz, zitiert in: Lardeau 1990, S. 45.
Die deutsche Erstaufführung fand schließlich am 1. Oktober 2009 unter der Intendanz und Regie von Roberto Ciulli im Theater an der Ruhr in Mülheim an der Ruhr statt. Vor der Premiere forderten der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Jüdische Gemeinde Duisburg/Mülheim, auf die Aufführung zu verzichten. Die Vorstellung ging dann aber vergleichsweise geräuschlos über die Bühne, von Kritikern mehrheitlich als harmlos, enttäuschend, unnötig oder gar nervig wahrgenommen, im besten Falle als »aufrichtig«. Vgl. etwa Vasco Boenisch in der Süddeutschen Zeitung, Stefan Keim in der Frankfurter Rundschau, Andreas Rossmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (alles am 5.10.2009) oder Andreas Wilink im Deutschlandradio (2.10.2009). Roberto Ciulli hatte eine Trilogie inszeniert und diese schlicht »Fassbinder« übertitelt. Darin war Der Müll, die Stadt und der Tod eingebettet zwischen Nur eine Scheibe Brot und Blut am Hals der Katze.
Fassbinder war finanziell an SCHATTEN DER ENGEL, Daniel Schmids Verfilmung des Stückes, beteiligt, der von Michael Fenglers Albatros Film produziert wurde. Neben bekannten Fassbinder-Schauspielern wie Klaus Löwitsch (Jude), Ingrid Caven (Lily/Roma B.), Irm Hermann, Ulli Lommel, Peter Chatel und Harry Baer spielte Fassbinder selbst die Figur des Franz B. (der im Film Raoul heißt).
Im Falle anderer Geschichten, die zunächst für die Bühne produziert wurden, wie zum Beispiel DIE BITTEREN TRÄNEN DER PETRA VON KANT, ist es klar, dass die Filmversion – trotz der Beibehaltung der Akteinteilung – den Prinzipien eines typischen Fassbinder-Films folgt und es sich dabei nicht um ein gefilmtes Fassbinderstück handelt.
Wie im vorangegangenen Kapitel konstatiert, hat Fassbinder in seinem Beitrag zu DEUTSCHLAND IM HERBST gerade nicht das Vater-Sohn-Paradigma aktualisiert, das häufig für die Auseinandersetzung mit dem Faschismus zwischen den Generationen im westdeutschen Film und in der Literatur gewählt wurde.
Fassbinder 1991, S. 681.
Ebenda, S. 703f.
Vergleiche Walter Benjamins Untersuchung Ursprung des deutschen Trauerspiels (deutsche Erstausgabe 1928; 1955 wiederveröffentlicht), die im Rahmen der Wiederentdeckung Benjamins in den sechziger Jahren heftig diskutiert wurde. W.B.: Ursprung des deutschen Trauerspiels. In: W.B.: Gesammelte Schriften, Bd. I/1. Hrsg. von R. Tiedemann. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1986, S. 203–430 (Taschenbuchausgabe 1991).
In dieser Hinsicht könnte man MST mit Brechts Lehrstück Die Maßnahme (1930) vergleichen.
Fassbinder 1991, S. 693.
Lichtenstein 1986, S. 213.
Vergleiche Fassbinder 1991, S. 682f.: »Franz B.: Was wars denn für einer? Ein Millionärssohn? Ein Tennisspieler? Und sowas lieben. Ich spucke auf dieses Geld. Ich spucke drauf. Roma B.: Er ist ein Jude. Ein dicker, häßlicher Jude. Keiner von denen, die du haßt, Franz, kein Tennisspieler. Einfach ein Jud.«
Hierin ähnelt sie Willie in LILI MARLEEN, die sich gleichfalls weigert, dem patriarchalischen Gesetz selbst der »guten« Juden zu folgen, oder Fassbinder in DEUTSCHLAND IM HERBST, der sich der patriarchalen Vater-Sohn-Folge widersetzt.
Fassbinder 1986, S. 83.
Herbert Riehl-Heyse: Lehrstück auf dünnem Eis. In: Süddeutsche Zeitung, 23.10.1985 (Wiederabdruck in: Lichtenstein 1986, S. 83).
Zitiert von Henryk Broder. Vergleiche Lichtenstein 1986, S. 214.
Fassbinder 1984, S. 38.
Vergleiche hierzu die Debatte zu SCHATTEN DER ENGEL in Frankreich (Le Nouvel Observateur, 28.2.1977, und Le Monde, 5., 18., 22. und 23.2.1977) und die Proteste in Rotterdam im November 1987.
Seyla Benhabib: R.W. Fassbinder’s CITY, GARBAGE AND DEATH. New German Critique, Nr. 38 (siehe Anm. 21), S. 19.
Fassbinder 1986, S. 88.
Bereits 1969 wies Fassbinder Kurt Raab an, den König Peter in Büchners Leonce und Lena nicht so zu spielen, wie er sich einen absolutistischen Fürsten vorstelle, sondern so, wie er glaube, dass sich die Spießbürger einen absolutistischen Fürsten vorstellen. Vergleiche Raab/Peters 1982, S. 44.
Gertrud Koch: Fassbinder und die Debatte zum »sekundären Antisemitismus« – vor der »dritten« liegt die »zweite Generation«. In: G.K.: Die Einstellung ist die Einstellung. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1992, 246ff., Zitat S. 249.
Koch bezieht LILI MARLEEN in ihre Überlegungen ein, weil Willie bereit sei, für ihren jüdischen Geliebten, den Komponisten, zu sterben. Vergleiche ebenda, S. 250.
Vergleiche Eric L. Santner: The Trouble with Hitler. In: New German Critique, Nr. 57, Sommer 1992, S. 5ff.
Vergleiche Friedländer 1992.
Besonders Broder in: Lichtenstein 1986, S. 212ff.
Norbert Seitz (Hg.): Die Unfähigkeit zu feiern. Frankfurt/Main: Verlag Neue Kritik 1985. Zitiert in: Thomas Elsaesser: Between Bitburg and Bergen-Belsen. In: On Film, Nr. 14, 1985, S. 38ff.
Philipp Jenninger: Von der Verantwortung für das Vergangene. In: Die Zeit, 25.11.1988.
Ein Jahr nach der Jenninger-Rede, am 9.11.1989, wurde die innerdeutsche Grenze geöffnet. Eric Santner hat in diesem Zusammenhang von einer »Anpassung des Gedächtnisses« gesprochen, was den 9. November ein weiteres Mal für eine »libidinöse Besetzung« öffne. Er fragte sich, ob die Freude über den Mauerfall die zögerliche Trauer über die »Kristallnacht« nicht vollends zum Schweigen bringen könne. Vergleiche Eric L. Santner: Fassbinder: History beyond the Pleasure Principle. In: Friedländer 1992, S. 144.
Als Beispiel kann man die Filme Alexander Kluges anführen. Vergleiche Thomas Elsaesser: Melancholie et mimétisme: les énigmes d’Alexander Kluge. In: Trafic, Nr. 31, Herbst 1999, S. 70–94.
Andreas Hillgruber: Zweierlei Untergang: Die Zerschlagung des Deutschen Reiches und das Ende des europäischen Judentums. Berlin: Siedler 1986.
Perry Anderson hat große Achtung vor dem historischen Wert von Hillgrubers Untersuchung geäußert. Siehe P.A.: On Emplotment: Two Kinds of Ruin. In: Friedländer 1992, S. 62f.
Ebenda, S. 58.
Vergleiche Alexander und Margarete Mitscherlich: Die Unfähigkeit zu trauern. München: Piper 1967.
Eric Rentschler hat dies angeführt in seinem Aufsatz: Remembering Not to forget: A Retrospective Reading of Kluge’s BRUTALITY IN STONE. In: New German Critique, Nr. 49, Winter 1990, S. 23ff.